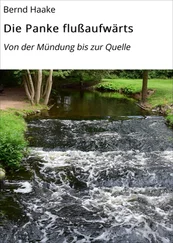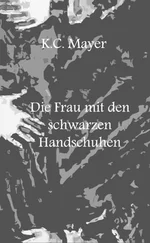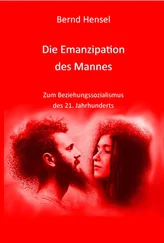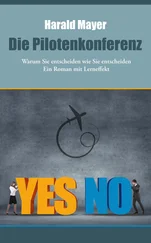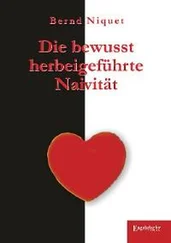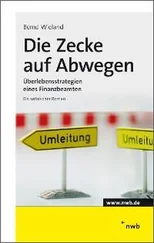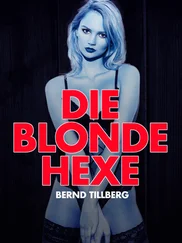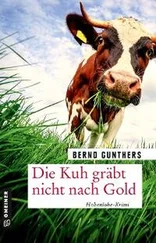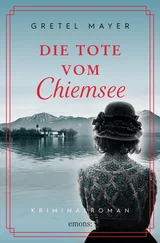3 Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums, nachgewiesen durch substanzspezifische Entzugssymptome oder durch die Aufnahme der gleichen oder nahe verwandter Substanzen, um Entzugssymptome zu vermindern oder zu vermeiden.
4 Nachweis einer Toleranz gegenüber der Substanz, im Sinne von erhöhten Dosen, die erforderlich sind, um die ursprüngliche durch niedrigere Dosen erreichte Wirkung hervorzurufen.
5 Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums sowie ein erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen.
6 Anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen.
Ob bei einem Großteil der Raucher drei dieser Kriterien erfüllt sind, weiß ich nicht. Mit Sicherheit fehlt aber das Kardinalsymptom substanzspezifischer Sucht, wonach Toleranz gegenüber dem Suchtstoff eine zunehmende Steigerung der zur Befriedigung erforderlichen Dosis zur Folge hat. Jedenfalls wäre ein beträchtlicher Anteil der Raucherinnen und Raucher gemäß WHO-Kriterien nicht abhängig, was aber Umfragen widerspricht, wonach 80 Prozent gerne aufhören würden, das aber nicht schaffen. Die WHO-Kriterien mögen für Heroinsucht anwendbar sein, sind aber offenbar nur sehr begrenzt für die Erfassung von Zigarettenabhängigkeit geeignet.
Als Alternative hat der schwedische Tabakforscher Karl Fagerström einen nach ihm benannten Test entwickelt, der mittels eines Punktesystems die Einstufung des Schweregrads der Nikotin- bzw. Zigarettenabhängigkeit ermöglichen soll [48].
Der Fagerström-Test (auf Seite 32) wurde in unzähligen Studien zum Abhängigkeitspotential des Rauchens eingesetzt. Die erzielte Punktezahl variiert mit Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Sozialstatus und anderen Faktoren, sodass die Angabe eines Mittelwerts weder möglich noch sinnvoll ist. Der Fragebogen wurde auch vielfach kritisiert und modifiziert. Besonders augenscheinlich ist, dass man selbst bei einer Punktezahl von 0 als „gering abhängig“ eingestuft wird, die Möglichkeit völliger Unabhängigkeit also nicht besteht. Zudem wurde gezeigt, dass die im Fagerström-Test ermittelte Punktezahl mit der Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten korreliert [49], der komplexe Fragebogen demnach schlichtweg überflüssig wäre. Unabhängig von den teilweise kontroversen Zahlen aufgrund der WHO-Kriterien und des Fagerström-Tests ist das starke Abhängigkeitspotential des Rauchens wohl augenscheinlich. Im Folgenden werde ich kurz die Mechanismen beschreiben, die dieser Abhängigkeit zugrunde liegen.
Ein gemeinsames Merkmal aller suchterzeugenden Substanzen ist die Freisetzung von Botenstoffen im Gehirn, sogenannten Neurotransmittern, die das Belohnungs- und Belohnungserwartungssystem aktivieren. Durch die Aussendung positiver Reize signalisieren diese Systeme Lust und Freude und motivieren uns durch diese „Belohnung“ zur Wiederholung der lustvollen Handlung. Allerdings gewöhnen wir uns sehr rasch an die positiven Reize und das Belohnungssystem fordert mehr, es fordert Steigerung der Lust. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Kaufsucht, bei der sich unmittelbar nach jedem Einkauf Unzufriedenheit einstellt und zur Befriedigung des Belohnungssystems der nächste Einkauf getätigt wird. Es wurde über Betroffene berichtet, bei denen hunderte nicht ausgepackte Warenpakete aufgefunden wurden. Wir tendieren also dazu, Handlungen zu wiederholen, die lustvolle Erfahrungen zur Folge hatten. Und das ist die Grundlage jeder Form von Sucht und Abhängigkeit.
FAGERSTRÖM-TEST FÜR ZIGARETTENABHÄNGIGKEIT
Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie Ihre erste Zigarette?
 nach 5 Minuten (3 Punkte)
nach 5 Minuten (3 Punkte)
 nach 6 bis 30 Minuten (2 Punkte)
nach 6 bis 30 Minuten (2 Punkte)
 nach 31 bis 60 Minuten (1 Punkt)
nach 31 bis 60 Minuten (1 Punkt)
 nach mehr als 60 Minuten (0 Punkte)
nach mehr als 60 Minuten (0 Punkte)
Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist, das Rauchen zu unterlassen?
 ja (1 Punkt)
ja (1 Punkt)
 nein (0 Punkte)
nein (0 Punkte)
Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen?
 die erste am Morgen (1 Punkt)
die erste am Morgen (1 Punkt)
 andere (0 Punkte)
andere (0 Punkte)
Wie viele Zigaretten rauchen Sie im allgemeinen pro Tag?
 31 und mehr (3 Punkte)
31 und mehr (3 Punkte)
 21 bis 30 (2 Punkte)
21 bis 30 (2 Punkte)
 11 bis 20 (1 Punkt)
11 bis 20 (1 Punkt)
 bis 10 (0 Punkte)
bis 10 (0 Punkte)
Rauchen Sie am Morgen im allgemeinen mehr als am Rest des Tages?
 ja (1 Punkt)
ja (1 Punkt)
 nein (0 Punkte)
nein (0 Punkte)
Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett bleiben müssen?
 ja (1 Punkt)
ja (1 Punkt)
 nein (0 Punkte)
nein (0 Punkte)
| AUSWERTUNG |
| 0 bis 2 Punkte: |
geringe Abhängigkeit |
| 3 bis 4 Punkte: |
mittlere Abhängigkeit |
| 5 bis 6 Punkte: |
starke Abhängigkeit |
| 7 bis 10 Punkte: |
sehr starke Abhängigkeit |
Der bedeutendste Aktivator des Belohnungssystems ist der Neurotransmitter Dopamin, der im Gehirn in den Basalganglien (genauer: im Striatum) durch endogene (körpereigene) Opiate ( Endorphine ) und Cannabinoide freigesetzt wird. Dopamin aktiviert Dopamin-Rezeptoren in einem für das Belohnungssystem sehr wichtigen Gehirnareal, dem sogenannten Nucleus accumbens ; durch Weiterleitung der Erregung an andere Gehirnstrukturen wird Zufriedenheit, Freude und Lust vermittelt. Die Freisetzung von Dopamin in den Basalganglien ist ein gemeinsames Merkmal der meisten missbräuchlich verwendeten Suchtstoffe, wie Amphetaminen, Opiaten oder Kokain [50]. Daher wird Dopaminfreisetzung durch eine bestimmte Substanz häufig als hinreichend für deren Einstufung als Suchtstoff erachtet. Allerdings sind die neuronalen Mechanismen der Erzeugung von Sucht sehr komplex und nur teilweise verstanden. Es besteht keine einfache Korrelation zwischen dem Suchtpotential einzelner Stoffe und dem Ausmaß der Dopaminfreisetzung, und langfristiger Drogenkonsum führt eher zu einer Abnahme der Aktivität dopaminerger Systeme [50]. Eine detaillierte Diskussion der neuronalen Mechanismen von Sucht und Abhängigkeit würde den Rahmen dieses Buches sprengen, daher wollen wir uns nun den Faktoren der Zigarettenabhängigkeit zuwenden. Ich spreche bewusst nicht von Tabakabhängigkeit, da unterschiedliche Tabakprodukte wie Pfeifen, Zigarren, Snus, Kautabak oder Wasserpfeifen jeweils unterschiedliches Abhängigkeitspotential haben, das durchwegs niedriger ist als jenes von Zigaretten.
Читать дальше
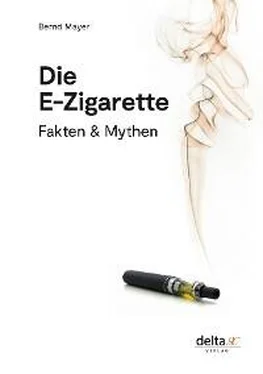
 nach 5 Minuten (3 Punkte)
nach 5 Minuten (3 Punkte)