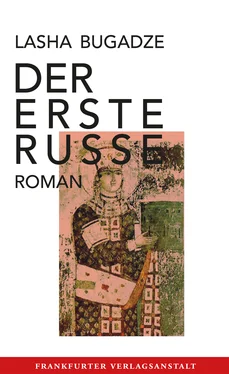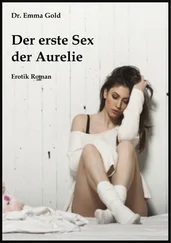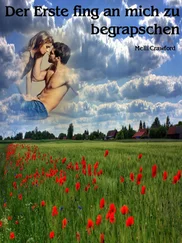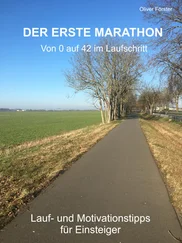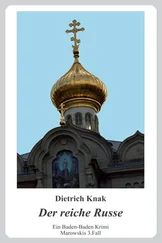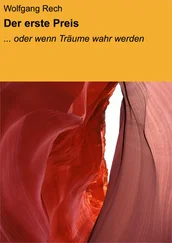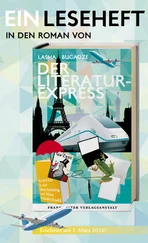1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 Präsident Gamsachurdias Dissertationsverteidigung war im georgischen Staatsfernsehen live übertragen worden: Die Wissenschaftler ergingen sich ganze fünf Stunden lang in Lobliedern auf das Werk des ehemaligen Dissidenten und Literaturkenners mit Spezialgebiet Schota Rustawelis »Recke im Tigerfell«. Die Übertragung wurde zeitweise unterbrochen, und als sie neu startete, war immer noch die Dissertation des Präsidenten Hauptmeldung des Tages.
Später, als auf einem Sender ein Imitatorenneuling mehr oder weniger erfolgreich den zukünftigen Präsidenten parodierte, beziehungsweise als er wie dieser die Faust schwang und den rechten Mundwinkel leicht hochzog, flimmerte der Bildschirm plötzlich in Regenbogenfarben: Offensichtlich war im unabhängigen Georgien das Parodieren des Präsidenten nicht erlaubt.
»Die alten Zensoren sitzen immer noch fest im Sattel, und wenn ich nicht darauf hinweise, setzen sie diese furchtbaren Gesetze um, ich verbiete nichts, jeder kann über mich lachen, wie er möchte«, rechtfertigte sich mein Klassenkamerad mit Dissidentenpräsidentenstimme. »Ich bitte dich, sehe ich jetzt etwa aus wie ein Zensor?«
»Tust du, mein Guter, ja«, antwortete ich mit Schewardnadses Stimme und Lächeln.
Dabei tat er das überhaupt nicht.
Am siebten April 1991 bestaunte ich ziemlich lange jenen Mann, der in zwei Tagen die Unabhängigkeit des Landes verkünden sollte.
Vater Dawit, der mir den Kontakt zu Außerirdischen verboten hatte, hielt zu jener Zeit Gottesdienste in Swetizchoweli ab, und ungeachtet dessen, dass meine Mutter und meine Tante gegenüber der neu erstarkten Kirche bereits skeptisch waren, schrieben sie trotzdem eine nicht besonders interessante Sündenliste auf einen Zettel und eilten zu ihrem nur unregelmäßig aufgesuchten Beichtvater. Anders als beim letzten Mal lehnte ich es diesmal entschieden ab, meine Sünden aufzuzählen, erklärte mich jedoch halbherzig bereit, zum Gottesdienst mitzukommen. Zunächst erschien uns die Kirche völlig leer – nur ein paar gelangweilte Mädchen sangen ohne Zuhörer, es stellte sich aber heraus, dass in der Ecke an einer unscheinbaren Säule Präsident Gamsachurdia stand, eine ziemlich lange Kerze in der Hand, sich leicht wiegend.
»Vielleicht war er nervös«, sagte mein Vater, als ich ihm von der Begegnung erzählte, »schließlich erklärt er bald die Unabhängigkeit, stell dir vor, wie gestresst er sein muss.«
Gestresst und vollkommen allein: Sein Dissidentenpartner Merab Kostawa war kurz zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen, von dem es hieß, er sei vom KGB inszeniert worden. Es war der Stil des sowjetischen KGB, einen Mord wie einen natürlichen Tod aussehen zu lassen. So war es in den Dreißigern des zwanzigsten Jahrhunderts und so wird es auch weiterhin sein – auch im Russland des einundzwanzigsten Jahrhunderts, wo unter der Regierung eines ehemaligen KGB-Offiziers politische Gegner »natürlich« umgebracht werden.
Nach der Tragödie des neunten April 1989 wurde es zur Regel, dass die Georgier, außer sich und verrückt vor Angst, ins Leichenschauhaus gingen oder davor Demonstrationen abhielten. Die Leute gingen dorthin, wo die bekannten Opfer lagen. Sie wollten die Toten sehen: »Zeigt uns die Verstorbenen!«
Diesmal waren Studenten zu dem Leichenschauhaus gegangen, in dem der Nationalheld lag. »Zeigt uns Merab Kostawa!«, schrien sie. Merab Kostawa lag auf einer Bahre. Jemand erzählte: »Ich hab nur seine Füße gesehen … Die Zehen schauten aus den zerrissenen Socken, weiter bin ich gar nicht reingegangen.« Er sagte das so, als ob am Tod dieses Mannes nur das »natürlich« war: eine zerrissene Socke.
Die Unabhängigkeit wurde am Jahrestag meiner ersten großen »Urangst« erklärt – am neunten April. Einige Monate später, als in Poti am Schwarzen Meer die erste nationale Marinemeisterschaft feierlich eröffnet wurde, begann in Moskau ein Putsch und der auf der Krim festgesetzte Michail Gorbatschow wurde politisch kaltgestellt. Nicht umsonst hatte ich mit Eduard Schewardnadses Stimme vorhergesagt: »Die Diktatur kommt!« Plötzlich schien die Sowjetunion zurückzukehren.
»Jetzt wird die Unabhängigkeit aufgehoben und unser armer Präsident festgenommen.« Unsere Nachbarin Tamara (eine von denen, die beim Zählen des Wunderheilers am schönsten einschliefen) war am Boden zerstört.
Die Rückkehr der Sowjetunion währte nur drei Tage lang. Der Moskauer Putsch endete so schnell, wie er begonnen hatte, aber jetzt war Tbilissi an der Reihe: Neun Monate nach der Unabhängigkeitserklärung wurde in Georgien Krieg geschürt.
Die Mitstreiter des Präsidenten und Rebellen legten innerhalb von vier Tagen den zentralen Prospekt in Schutt und Asche. Kaum zu glauben, dass auch jener Imitator ein Maschinengewehr trug, dessen Präsidentenparodie im Fernsehen unterbrochen worden war: »Wir sollten ihn am lebendigen Leibe in seinem Bunker schmoren!«, sagte er diesmal mit seiner eigenen Stimme. Der dreiundzwanzigjährige Rebellengeneral verkündete der Bevölkerung stolz, wenn der Präsident nicht zurücktrete, werde er das Regierungsgebäude mit Bomben bewerfen und das ganze Sololaki-Viertel in die Luft sprengen.
Da die Rebellen das Rundfunk- und Fernsehgebäude eingenommen hatten, wurden die Sendungen in einem Bus aufgezeichnet, der im Hof des umzingelten Regierungsgebäudes stand. Aus diesem »Fernsehbus« beschimpften sie entweder haltlos die bis an die Zähne bewaffnete Opposition oder, nett ausgedrückt, deuteten den Zuschauern subtil an, welche Katastrophen der Umsturz der gesetzmäßigen Regierung zur Folge haben würde. Auf dem Rustaweli-Prospekt waren schon Schüsse gefallen, als der regierungstreue »Fernsehbus« uns eine amerikanische Verfilmung von Shakespeares »Julius Cäsar« präsentierte. Die Leute hätten normalerweise gleich erkennen müssen, wer Cäsar war und wer Brutus (der ehemalige Premierminister, jetzt Rebellenführer, von dem es hieß, er spritze sich Drogen ins Zahnfleisch), aber jetzt nahm keiner mehr die Allegorien wahr – im Stadtzentrum wurde scharf geschossen. Doch während die unterschwellige Botschaft von »Julius Cäsar« noch einigermaßen naheliegend schien, war die Ausstrahlung der Kinoversion von Giuseppe Verdis »Rigoletto« zwei Tage vor der Flucht des Präsidenten vollkommen rätselhaft. Was wollte man den Zuschauern damit sagen?
Der Präsident des unabhängigen Georgiens floh genau an dem Tag, als die Sowjetunion offiziell aufhörte zu existieren.
Drei Monate nach Ende des Tbilisser Krieges kehrte »meine Stimme« nach Georgien zurück und wandte sich noch am Flughafen an seine Unterstützer: »Als es notwendig wurde, nahm die Intelligenzija die Waffe in die Hand und verteidigte unter Einsatz ihres Lebens die Demokratie.«
Als 1993 der achtmonatige Abchasienkrieg ausbrach und bei der Generation meiner Eltern Frustration auslöste, saß die Bevölkerung mehrheitlich wieder treu vor dem Fernseher und versuchte, durch den Konsum neu aufgekommener mexikanischer Seifenopern abgestumpfte Gefühle wiederzuerwecken. Die Serie »Auch die Reichen weinen« lief einen Monat länger als der Krieg, doch es war genau an dem Tag der Strom abgeschaltet, als sich das zerstrittene Ehepaar in der zweihundertfünfzigsten Folge versöhnen sollte. Der Strom fiel aus und wurde jahrelang nicht wieder angeschaltet, die vier Jahreszeiten traten außer Kraft. Überall lag der Geruch verbrannten Holzes in der Luft, und es wurde für lange Zeit dunkel. Das Baden entfiel für Jahre. »Meine Stimme« kam wie durch ein Wunder mit dem Leben davon: In den letzten Tagen des Abchasienkrieges wurde versucht, Eduard Schewardnadses Hubschrauber mit einem russischen Maschinengewehr abzuschießen. In Tbilissi wurde immer noch geschossen, denn jetzt hatte jeder eine Waffe.
Jetzt war allen alles erlaubt.
Eine Welt ohne Liebe. Durchsetzungswille im Chaos
Читать дальше