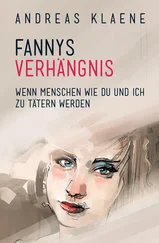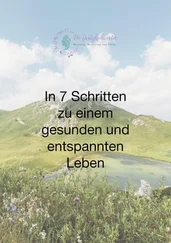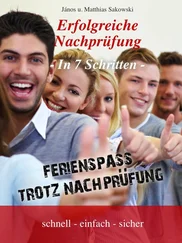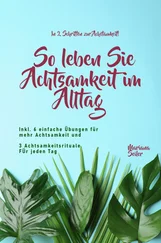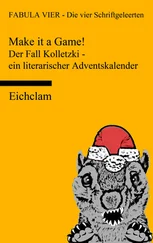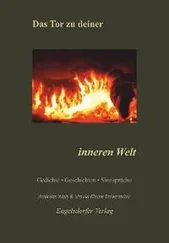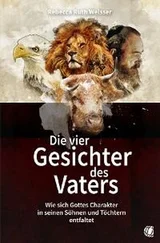Als Ausweg aus diesem Dilemma werden den Krankenhäusern zusätzlich zu den DRGs Kosten für definierte Leistungen über Zusatzentgelte vergütet, und die entsprechenden Kosten bleiben bei der DRG-Kalkulation unberücksichtigt. Mit der Festlegung von ZE wird also die Katalogerweiterung um zusätzliche DRG-Fallpauschalen vermieden, und es wird eine leistungsgerechte Vergütung der betroffenen Verfahren und Prozeduren erreicht. Zur Kalkulation von ZE fordert das InEK bei Bedarf – häufiger als zur Kalkulation der DRGs – ergänzende Daten von den Kalkulationskrankenhäusern an. Somit kann die für die DRG-Kalkulation beschriebene »kalkulatorische Lücke« (  Kap. 3.4) verkürzt werden und die Kostendaten können bereits im Folgejahr in die Erlöskalkulation einfließen.
Kap. 3.4) verkürzt werden und die Kostendaten können bereits im Folgejahr in die Erlöskalkulation einfließen.
Die Zusatzentgelte werden, wie die DRGs, jährlich vom InEK definiert, kalkuliert und im Fallpauschalenkatalog veröffentlich. Diese Entgelte werden zumeist über eine Prozedurenkodierung angesteuert.
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Zusatzentgelten:
 ZE mit einem bundeseinheitlichen Preis, diese finden sich in den Anlagen 2 und 5 der Fallpauschalenvereinbarung. Für diese ZE wird vom InEK ein fester Eurobetrag für das Entgelt festgelegt.
ZE mit einem bundeseinheitlichen Preis, diese finden sich in den Anlagen 2 und 5 der Fallpauschalenvereinbarung. Für diese ZE wird vom InEK ein fester Eurobetrag für das Entgelt festgelegt.
 Krankenhausindividuell zu vereinbarende ZE aus den Anlagen 4 und 6 der Fallpauschalenvereinbarung. Für diese ZE wird auf Ortsebene zwischen Krankenhaus und Kostenträgern im Rahmen der jährlichen Budgetvereinbarungen ein Preis verhandelt. Das bedeutet für das Krankenhaus (speziell für das Controlling) einerseits einen erheblichen Aufwand für die Kalkulation der geforderten Preise. Andererseits besteht die Chance, durch eine transparente und nachvollziehbare Kalkulation tatsächlich eine Kostendeckung für die betroffenen Prozeduren sicherzustellen. Gleiches gilt für die oben beschriebenen nicht bewerteten G-DRG-Fallpauschalen.
Krankenhausindividuell zu vereinbarende ZE aus den Anlagen 4 und 6 der Fallpauschalenvereinbarung. Für diese ZE wird auf Ortsebene zwischen Krankenhaus und Kostenträgern im Rahmen der jährlichen Budgetvereinbarungen ein Preis verhandelt. Das bedeutet für das Krankenhaus (speziell für das Controlling) einerseits einen erheblichen Aufwand für die Kalkulation der geforderten Preise. Andererseits besteht die Chance, durch eine transparente und nachvollziehbare Kalkulation tatsächlich eine Kostendeckung für die betroffenen Prozeduren sicherzustellen. Gleiches gilt für die oben beschriebenen nicht bewerteten G-DRG-Fallpauschalen.
Inhaltlich handelt es sich um ganz unterschiedliche Leistungen. Häufig werden teure Arzneimittel, Spezialimplantate usw., also sachkostenintensive Leistungen durch ZE vergütet. Aber auch Komplexbehandlungen, z. B. für pflegeintensive oder palliativmedizinisch versorgte Patienten, können ZE-relevant sein.
3.7 Refinanzierung durch Zusatzentgelte
Um einen ersten Überblick über die Refinanzierung der ZE-relevanten Leistungen zu erhalten bietet es sich an, die Refinanzierungsquote für die im eigenen Haus angewendeten Verfahren zu überwachen.
Die Refinanzierungsquote setzt die ZE-Erlöse für eine bestimmte Leistung, z. B. für ein Arzneimittel, ins Verhältnis zu den Kosten. Sie ist damit abhängig vom Einkaufspreis des jeweiligen Verfahrens, z. B. eines Arzneimittels, von der Erfassungsquote (Kodierqualität!) sowie bei den nicht bewerteten ZE von der vereinbarten Entgelthöhe.
Man darf auch bei »guten« Einkaufspreisen und vollständiger OPS-Erfassung nicht erwarten, dass die Refinanzierungsquote durchgängig bei 100 % liegen wird. ZE sollen in aller Regel nicht die Kosten für die entsprechende Leistung vollständig refinanzieren. Vielmehr werden mit den vom InEK kalkulierten Preisen Differenzkosten zu einem Standardverfahren finanziert, welches in den entsprechenden DRGs berücksichtigt ist. Der Differenzkostenansatz ist auch bei der Kalkulation unbewerteter ZE durch das Krankenhauscontrolling zu berücksichtigen.
Beispiel: Wenn bei einem kardiologischen Patienten eine Gefäßstütze (Stent) implantiert werden soll, so bestehen aus medizinischer Sicht mehrere Optionen. U. a. kann ein nicht beschichteter, sogenannter »bare metal stent« implantiert werden. Die Kosten für diesen Stent sind in der entsprechenden DRG vom InEK berücksichtigt. Alternativ kann ein medikamentenbeschichteter Stent verwendet werden, für den – eine korrekte Kodierung vorausgesetzt – ein ZE abgerechnet werden kann. Das ZE finanziert nicht die Kosten für den beschichteten Stent, sondern die Differenzkosten zwischen bare metal stent und medikamentenbeschichtetem Stent.
Die Refinanzierungsquote kann also für einzelne Artikel unter 100 % liegen, ohne dass man zwangsläufig von einem unwirtschaftlichen Einsatz ausgehen muss. Die Alarmglocken sollten allerdings läuten, wenn sich die Refinanzierungsquote im Zeitverlauf (plötzlich) reduziert; dies könnte dann z. B. mit schlechteren Einkaufskonditionen, mangelhafter Kodierung oder verändertem Verordnungsverhalten zusammenhängen.
In Kap. 11.6 werden wir an einem praktischen Beispiel die Refinanzierungsquote durch ZE herleiten (  Kap. 11.6).
Kap. 11.6).
Zusatzentgeltrelevante Leistungen können nur abgerechnet werden, wenn das Krankenhaus mit den Kostenträgern eine entsprechende Budgetvereinbarung getroffen hat. Dies sollte man bedenken, wenn z. B. Handelsvertreter darauf hinweisen, dass ein neues, im Haus bisher nicht eingesetztes Verfahren, durch Zusatzentgelte »mehr als refinanziert« wird. Kontaktieren Sie in solchen Fällen Ihr Controlling, um die Abrechnungsmöglichkeiten abzustimmen!
3.8 Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB)
Im Sinne eines lernenden Systems werden gemäß § 6 Abs. 2 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB), die mit den vorhandenen Fallpauschalen und Zusatzentgelten noch nicht sachgerecht vergütet werden können, über zeitlich befristete, fallbezogene Entgelte jenseits der bestehenden Kataloge vergütet. Die Abrechnungsmodalitäten ähneln den im vorigen Abschnitt beschriebenen krankenhausindividuell zu vereinbarenden Zusatzentgelten, allerdings ist für das einzelne Krankenhaus eine Hürde zu nehmen, bevor die Leistung mit den Kostenträgern verhandelt werden kann: bis spätestens 31.10. des Vorjahres muss beim InEK ein Antrag gestellt werden. Nur bei einer entsprechenden positiven Bewertung durch das InEK ist dann überhaupt die Möglichkeit gegeben, die Leistung in die Forderung im Rahmen der jährlichen Budgetverhandlungen aufzunehmen. Da eine bundeseinheitliche Festlegung für den Preis nicht besteht, ist dieser wie bei den nicht bewerteten ZE auf der örtlichen Ebene zu verhandeln.
Details hierzu sind der »NUB-Vereinbarung« gem. § 6 Abs. 2 KHEntgG zu entnehmen.
3.9 Aktuelle Weiterentwicklung des DRG-Systems
Mit der Einführung der G-DRGs wurden die Krankenhäuser gezwungen, die Wirtschaftlichkeit ihrer medizinischen Leistungen zu verbessern und sich einem (Verdrängungs-)Wettbewerb zu stellen. Die normierten Preise für definierte medizinische Leistungen bewirken, dass wirtschaftlicher Erfolg insbesondere durch effiziente Prozesse und durch optimale Auslastung der Ressourcen erreicht wird. In den letzten Jahren wurde zunehmend kritisiert, dass durch diese Effekte Fehlanreize gesetzt werden. Insbesondere wurde den Krankenhäusern immer wieder vorgeworfen, ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit zulasten der Personalausstattung, insbesondere im Pflegedienst, sowie der Behandlungsqualität zu optimieren.
Der Gesetzgeber hat auf diese Kritik reagiert und insbesondere mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG, 2015) und mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG, 2018) Bedingungen geschaffen, die zu durchgreifenden Veränderungen der Finanzierung von Krankenhausleistungen und damit auch der Sachkostenfinanzierung führen. Durch die verschiedenen Maßnahmen sollen vor allem die Qualität der medizinischen Leistungen und die (Pflege-)Personalausstattung nachhaltig gestärkt werden. Weiterhin sollen Fehlanreize reduziert werden, die in der Vergangenheit zu Mengensteigerungen für vermeintlich lukrative Leistungen geführt haben sollen. Die wichtigsten Änderungen werden nachfolgend erläutert.
Читать дальше
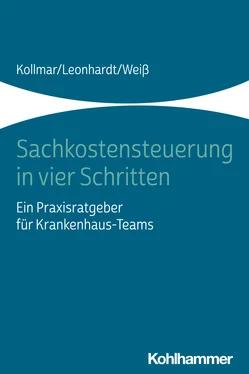
 Kap. 3.4) verkürzt werden und die Kostendaten können bereits im Folgejahr in die Erlöskalkulation einfließen.
Kap. 3.4) verkürzt werden und die Kostendaten können bereits im Folgejahr in die Erlöskalkulation einfließen. ZE mit einem bundeseinheitlichen Preis, diese finden sich in den Anlagen 2 und 5 der Fallpauschalenvereinbarung. Für diese ZE wird vom InEK ein fester Eurobetrag für das Entgelt festgelegt.
ZE mit einem bundeseinheitlichen Preis, diese finden sich in den Anlagen 2 und 5 der Fallpauschalenvereinbarung. Für diese ZE wird vom InEK ein fester Eurobetrag für das Entgelt festgelegt.