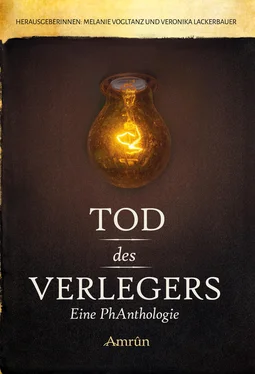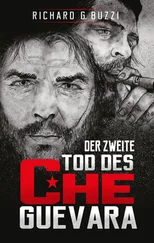War ich überrascht, als er vor einem Monat vor meiner Tür stand und mich um ein Darlehen anbettelte? Nicht wirklich. Das Ausmaß meiner Überraschung war ebenso groß wie das meiner Freude über seinen Besuch – nicht existent. Er behauptete, dass er niemals gewagt hätte, sich an mich zu wenden, würde es sich nicht um eine absolute Notlage handeln: Sein Verlag sei bankrott, und Benjamin selbst schwerkrank. »Der Arzt gibt mir nur noch wenige Wochen«, sagte er. »Bevor ich gehe, möchte ich noch dieses eine Buch machen – ein ganz besonderes Buch mit ganz besonderen Geschichten. Aber wenn du mir nicht finanziell unter die Arme greifst, wird daraus nicht. Bitte, Katja – erfülle einem Sterbenden seinen letzten Wunsch. Ich habe die Geschichten mitgebracht. Wenn du sie liest, wirst du bestimmt verstehen, warum sie mir so wichtig sind.«
Was soll ich sagen? Ich habe ihn samt Manuskriptstapel vor die Tür gesetzt. Schön, ich gebe zu, das war kein feiner Zug, und ich bin auch nicht stolz darauf. Aber zu meiner Verteidigung: Ich wusste ja nicht, dass er die Sache mit der tödlichen Krankheit ernst meinte. Benjamin brachte andauernd solchen Mist – erfand Krankheiten, Räumungsaufforderungen oder Todfeinde, um seinen Willen durchzusetzen. Wahrheit war für ihn etwas, mit dem sich nur die Fantasielosen herumplagen mussten. Als ich ihn einmal mit seinen Lügengeschichten konfrontierte, da sagte er: »Ich lüge nicht, ich erzähle Geschichten.« Auf meine Frage, was der Unterschied sei, antwortete er: »Eine Lüge verfälscht die Tatsachen aus egoistischen Gründen. Eine Geschichte beleuchtet die Tatsachen aus einem anderen Blickwinkel, um eine tiefere Wahrheit aufzudecken.« Ja, solchen geschwurbelten Stuss konnte er von sich geben, ohne rot zu werden.
Aber dieses eine Mal hatte er keine Geschichte erzählt. Ein paar Wochen darauf wurde ich über seinen Tod benachrichtigt. Der metastasierende Darmkrebs hatte ihn dahingerafft. Ein wenig überkam mich bei dieser Nachricht dann doch ein Anflug von schlechtem Gewissen, aber mal ehrlich. Es war nicht meine Schuld! Wie in diesem Märchen über den Jungen, der immer »Wolf« schreit, hat Benjamin mich einmal zu oft belogen und dafür seine Strafe erhalten.
Verdammter Idiot.
Ticktockticktock.
Wieder wird mein Blick von dem Apparat angezogen. Bestimmt habe ich Benjamin mit meiner Abfuhr nicht glücklich gemacht. Aber würde er mir tatsächlich noch über den Tod hinaus grollen? Es ist ja nicht so, dass er sonderlich viel von seinem Racheakt hätte – keine Schadenfreude, keine Befriedigung. Aber wann hat Benjamin sich jemals logisch verhalten?
Ich beuge mich über das Kästchen. Nehme es in die Hand, neige es von einer Seite zur anderen. Das Ticken wird schneller. Hastig stelle ich es wieder an seinen Platz. Kommt es mir nur so vor oder ist etwas Kleines darin verrutscht, als ich es bewegt habe? Ich gehe davor in die Hocke. Schnuppere daran. Merke im nächsten Moment, wie lächerlich ich mich verhalte. Ich bin kein verdammter Bombenspürhund, und selbst wenn mein Geruchssinn besser wäre, was erwarte ich zu riechen? Den Code?
Ticktockticktock.
Verstohlen wische ich mir eine Schweißperle ab, die auf meiner Nasenspitze kitzelt.
Wenn Benjamin denkt, ich spiele sein krankes Spiel ohne Gegenwehr mit, hat er sich geschnitten. Ich ziehe mein Handy aus der Hosentasche. Es ist denkbar einfach, was ich nun tun muss: Ich werde die Nachlassverwalterin anrufen, ihr sagen, dass ich mich versehentlich im Keller eingesperrt habe und sie bitten, mir von außen zu öffnen. Kein Drama. Dass Benjamin diese simple Lösung nicht vorausgesehen hat, wundert mich nicht, er hat ja noch nie in der Gegenwart gelebt.
Mein Gesicht entgleist, als mein Blick auf das Display fällt. Kein Empfang, nicht einmal ein winziger Balken. Es ist wie in einem dieser miesen Filme, die ich manchmal spätnachts laufen lasse, wenn ich nicht einschlafen kann.
»Mistding«, zische ich meinem Handy zu, obwohl das Gerät eigentlich völlig unschuldig ist. Die wahren Übeltäter sind wohl die gut isolierten Kellerwände.
Vielleicht werfe ich doch mal einen Blick in die Kartons mit den Geschichten. Kann ja nicht schaden, richtig? Und wie es aussieht, werde ich hier sowieso nicht so bald rauskommen. Da kann ich mir eigentlich genauso gut was zum Lesen nehmen.
Es sind insgesamt drei Kartons, kaum größer als Schuhschachteln. Am Rand sind sie mit Benjamins fast unleserlicher Sauklaue beschriftet. Auf einer Schachtel steht »Märchenhaft«, auf einer »Abenteuerlich« und auf der letzten »Unheimlich«. »Märchenhaft« klingt am wenigsten anstrengend zu lesen, damit sollte ich wohl am schnellsten durch sein. Ich setze mich auf einen Stuhl, hebe die Schachtel auf meinen Schoß und nehme den Deckel ab. Zum Vorschein kommen mehrere Papierbündel, mit Heftklammern fein säuberlich zusammengehalten. Ich unterdrücke ein Seufzen, als ich beim Durchblättern die eng bedruckten Zeilen sehe. So viel Schrift!
Ticktockticktock.
Na gut, es hilft ja nichts. Vielleicht habe ich ja Glück und finde den Code schon in der ersten Geschichte. Oder wenigstens in der ersten Schachtel.
Ich will bereits mit dem ersten Bündel anfangen, da kommt mir eine brillante Idee. Bestimmt hat Benjamin diese Reihenfolge nicht ohne Grund ausgesucht; er will, dass ich das oberste Bündel als Erstes greife. Ich wette, es war sein Plan, dass ich so viele Geschichten wie möglich lese, bevor ich nach draußen gelange. Der Code ist also in einem der letzten Bündel – völlig logisch. Aber so leicht lasse ich mich von ihm nicht foppen!
Ich wühle mich in der Schachtel nach unten und zerre die Geschichte heraus, die auf dem Boden des Kartons liegt. Dass ich dabei einige Eselsohren produziere, verschafft mir eine grimmige Befriedigung.
Mit dem unheilvollen Ticken im Ohr fange ich an zu lesen.
Märchenhaft
1. Kiste
Herzen und
Mondsteine
Renée Engel
Neugierig drückte sie die Nase gegen das Fenster. Das spärliche Licht des Winternachmittags reichte nur wenige Meter in den Laden, vorbei an nahezu antiken Holzregalen rechts und links, in dem sich zerfledderte Bücher, alte Töpfe und Holzspielzeug stapelten.
Unsicher schob Marleen eine Strähne hinter das Ohr und trat ein paar Schritte zurück. Bestimmt war sie schon hundertmal an dieser schmalen Gasse vorbeigekommen, ohne sie zu beachten. Sie war so eng, dass der Übergang vom Bürgersteig zur Straße lediglich durch eine gemauerte Rinne markiert wurde, durch die das Regenwasser ablief. Kopfsteinpflaster machte den Boden uneben und das Gehen mühsam. Die ganze Straße wirkte dermaßen aus der Zeit gefallen, dass Marleen nicht mal über Gaslaternen als Beleuchtung überrascht gewesen wäre.
Ihr Blick kletterte die Fassade hinauf. Kleine Erker hier und da versperrten dem Licht den Weg, und stumpfe Fenster starrten blind auf die gegenüberliegende Hauswand. Kein Anwohner kontrollierte, wer sich in dieses abgelegene Viertel verirrt hatte, keine Gardine bewegte sich. Einzig die Briefkästen, die nicht überquollen, deuteten auf einen Rest von Leben.
Der Laden bot das gleiche, trostlose Bild. Der Zahn der Zeit hatte am Putz und einem Teil der Hausnummer genagt, und der verbliebene Rest war so dunkel, dass er mit der schmutzigen Fassade quasi verschmolz.
Ein letztes Mal suchten ihre Augen nach Hinweisen, ob sie wirklich an der richtigen Adresse stand. ALBERT NICOLAS MONDSTEIN, AN- UND VERKAUF, stand in grauen Lettern auf der vor Schmutz nahezu undurchsichtigen Scheibe. Der Name, der sie aus dem Albtraum, zu dem ihr Leben geworden war, befreien sollte.
Was ist jetzt? Reingehen oder verschwinden?, dachte sie.
Der Wind trieb ein paar tote Blätter vor sich her, vereinzelte Schneeflocken trudelten zu Boden. Ihre Fingernägel waren blau vor Kälte. Seit Tagen hatte sie das Gefühl, nie wieder warm zu werden. Genaugenommen seit dem Morgen, als der Arzt meinte, es gäbe für Patrick keine Hoffnung mehr.
Читать дальше