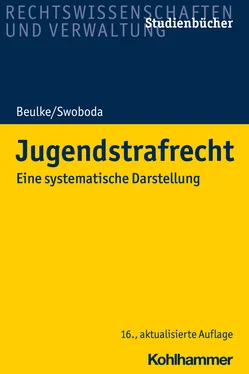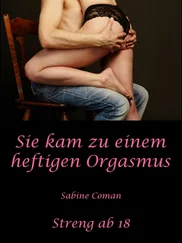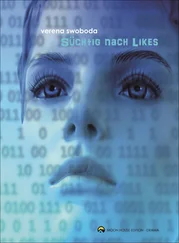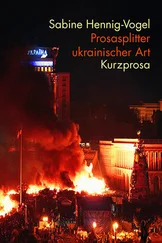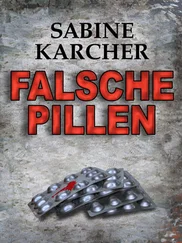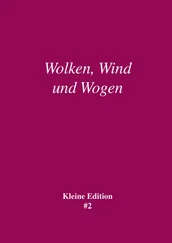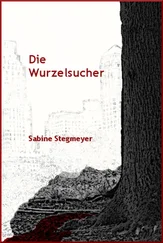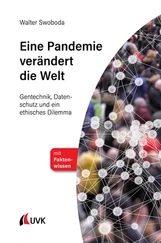Die Pubertät ist nicht nur ein körperlicher Reifungsvorgang, der mit dem Wachstum und dem In-Funktion-Treten der Sexualorgane sowie der Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale (Schambehaarung, Stimmbruch usw.) äußerlich erkennbar wird. Vielmehr ist diese körperliche Umwälzung regelmäßig mit einer mehr oder minder schweren Krise der seelischen Entwicklung verbunden, die weit über den Bereich des Sexuellen hinausgeht. Sie ist vor allem geprägt von einem starken Drang nach Erlebnissen, Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung sowie dem Bedürfnis nach Partnerschaften, ohne dass immer entsprechende Realisierungschancen bestünden. Ferner ist charakterisierend die leichte Verführbarkeit des jungen Menschen bei gleichzeitiger Ablehnung von Autorität und Zwang. 26
19b) Zu diesen biologisch-psychologischen Kennzeichen der Pubertät tritt nun als ein kriminalsoziologisch kaum minder bedeutsamer Umstand hinzu, dass der junge Mensch in dieser kritischen Periode sich regelmäßig aus der relativen Geborgenheit des Elternhauses löst oder zumindest dort eine ganz neue Rolle einnimmt. Mit dem Übergang aus Familie und Schule in das Arbeits- und Berufsleben tritt er in eine völlig neue Umwelt ein. Diese aber hält eine Fülle neuer Anforderungen, Einflüsse und Versuchungen für ihn bereit, zu deren seelisch-charakterlicher Bewältigung er gerade in diesem Stadium puberaler Labilität und Unausgeglichenheit vielfach noch nicht im Stande ist.
Wenn nun auch die Zusammenhänge zwischen Pubertät, Sozialisation und Kriminalität in ihren Einzelheiten noch nicht hinreichend geklärt und daher noch vielfach kontrovers sind, so ist doch unbestreitbar, dass nicht etwa nur die Sittlichkeits- und die Aggressivitätsdelikte, sondern auch zahlreiche sonstige Straftaten Jugendlicher und Heranwachsender auf die biologische und soziologische Krisensituation der Reifezeit zurückzuführen sind. Für die strafrechtliche Behandlungdieser Täter ergeben sich daraus mannigfache Konsequenzen. Ihre Schuldfähigkeit kann durch pubertätsbedingte Störungen des seelischen Gleichgewichts herabgemindert oder ausgeschlossen sein. Aber auch wenn sie zu bejahen ist, bleibt die Frage, ob es sinnvoll und gerechtfertigt ist, die ganze Zukunft des jungen Menschen durch die Bestrafung einer Tat in Frage zu stellen, die nur Ausdruck einer ihrer Natur nach vorübergehenden Entwicklungsstufe ist. Zwar ist das Bedürfnis der Allgemeinheit nach schuldproportionaler Sühne und nach Schutz auch angesichts einer Jugendstraftat zu beachten, aber es wäre kurzsichtig, wenn man dabei übersähe, dass dieses Bedürfnis in einer der spezifischen Eigenart des Jugendlichen angepassten Form befriedigt werden muss. Denn sonst würde die rechtliche Reaktion auf die Tat eines Heranreifenden, dessen Charakter gerade durch die Lebenserfahrungen dieser Jahre geprägt wird, die Gefahr seines weiteren kriminellen Abgleitens begründen und dadurch sowohl ihn selbst wie die Allgemeinheit nur umso stärker gefährden.
3.Beeinflussbarkeit und Formbarkeit des jungen Menschen
20Mit dieser letzten Erwägung ist bereits ein weiterer Gesichtspunkt angedeutet, der nun freilich nicht nur die pubertierenden Jugendlichen, sondern mehr oder minder alle jungen Täter von den älteren unterscheidet: Die größere Formbarkeit junger Menschen . Erst zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr kommt die charakterliche Entwicklung zu einem gewissen Abschluss. In diesem Sinne spricht die Kriminologie von der besonderen Umweltabhängigkeit der Jugendkriminalität. Für die Entstehung der Jugendkriminalität haben zerrüttete Familienverhältnisse, Erziehungsmängel, schlechtes Beispiel der Eltern, Geschwister und Freunde, Verführung, negative Einflüsse, die von Filmen, Fernsehen, gewaltverherrlichenden oder pornographischen Internetangeboten und PC-Rollenspielen und vergleichbarer Literatur ausgehen, eine weit größere Bedeutung als es entsprechende ungünstige Umwelteinwirkungen für die Kriminalität der älteren Jahrgänge haben, weil sich in Abhängigkeit zu den Umweltbeziehungen die Wahrnehmung der Regelgeltung und die verhaltenssteuernde Kraft der Sanktionsrisikoeinschätzung verändert. 27Umgekehrt folgt nun aber aus der stärkeren Prägbarkeit der jugendlichen Straffälligen, dass bei ihnen eine günstige Veränderung der Umwelt und beharrliche Erziehungsarbeit wesentlich eher Erfolg verspricht als bei den Älteren, deren Charakter sich bereits im negativen Sinne verfestigt hat. Diese größeren Erfolgschancen rechtfertigen es, der spezialpräventiven Verbrechensvorbeugung durch Erziehung eine weit stärkere Bedeutung beizumessen, als ihr im Rahmen der Strafzwecke des allgemeinen Strafrechts zukommt.
4.Jugendkriminalität als ubiquitäres Phänomen – jugendliche Intensivtäter
21Indessen ist keineswegs jede Jugendstraftat nur als pubertäre Entgleisung oder als Ergebnis relativ leicht behebbarer Umwelteinflüsse anzusehen. Es kann sich auch um das Frühsymptom einer tieferen Persönlichkeitsstörung handeln. Dabei ist es für die strafrechtliche Bewertung unwesentlich, ob die Persönlichkeitsstörung auf eine Erbanlage zurückzuführen ist oder ob sie das Ergebnis einer erzieherischen Fehlentwicklung darstellt, die unter Umständen ihren Ursprung im frühsten Kindesalter hat. Denn in jedem Fall liegt es nahe, dass sich eine solche Auffälligkeit schon früh äußert, mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls dann, wenn das soziale Verhalten durch die Pubertät und den Eintritt in das Arbeits- und Berufsleben der ersten großen Belastungsprobe ausgesetzt wird.
22Auf die besondere Bedeutung des Frühbeginns der Kriminalität für spätere Rückfälligkeit wird in zahlreichen in- und ausländischen Untersuchungen der Lebensläufe Vielfach-Rückfälliger immer wieder hingewiesen. Bei der Untersuchung des Ehepaars Glueck 28lag der Erfolg der untersuchten Bewährungsprobanden bei 9 %, sofern sie bis zum 11. Lebensjahr das Erstdelikt begangen hatten, hingegen bewährten sich 33 %, wenn das Erstdelikt erst mit 17 Jahren oder später begangen wurde. Nach Weiher 29lag das Durchschnittsalter der von ihm untersuchten jugendlichen Vielfachtäter zum Zeitpunkt der ersten gerichtlichen Verurteilung bereits bei 15,3 Jahren.
23Andererseits kann die Kriminologie bis heute keinen monokausalen Zusammenhang zwischen Frühkriminalität und späterer Rückfälligkeit feststellen. 30Zwar haben spätere Intensivtäter ihre kriminelle Karriere häufig relativ früh begonnen, 31jedoch hat auch bei sehr jungen Straftätern die Kriminalität zumeist nur episodenhaften (passageren) Charakter, und die Straffälligkeit erledigt sich dann mit dem Abklingen der Pubertät und der Bewältigung des sozialen Rollenwechsels. 32Es ist bis heute nicht gelungen, sozusagen im Frühstadium die Gruppe der nur vorübergehend Auffälligen von der der später vielfach Rückfälligen zu unterscheiden. Vor allem die Ergebnisse der so genannten Kohorten-Forschung, bei der der Geburtsjahrgang einer bestimmten Region im Langzeitvergleich insgesamt auf sein registriertes und nichtregistriertes Legalverhalten befragt wird, haben keine Indikatorenwirkung der Frühkriminalität nachgewiesen. 33Einzelstudien ergaben allenfalls, dass die Wahrscheinlichkeit, nach dem 14. Lebensjahr mehrfach registriert zu werden, für kindliche Mehrfachtäter doppelt so hoch ist wie für kindliche Einfachtäter. Gleichzeitig aber zeigten die Ergebnisse auch, dass sich die Delinquenz im Kindesalter nur dann zu einer persistierenden, chronischen Delinquenz entwickelt, wenn auch nach dem 14. Lebensjahr mehrfach Straftaten begangen werden. 34Deshalb kann bei dem heutigen Wissensstand die Aussagekraft des sehr frühen Einsetzens der Straffälligkeit doch nur mit äußerster Zurückhaltung bewertet werden. 35Nicht die mehrfache Registrierung im Kindesalter, sondern die Mehrfachtatbegehung während der Adoleszenz stellt die Weichen für eine kriminelle Karriere. Ein – wenn auch schwacher – Zusammenhang besteht zwischen früher krimineller Auffälligkeit allenfalls dann, wenn die erste Tat bereits vor dem 11. Lebensjahr stattgefunden hat. Bedeutend für das spätere Legalverhalten ist zudem eher die Deliktsgruppe der ersten Registrierung als das Alter. Besonders ungünstig erscheinen schwere Eigentumsdelikte und Raubdelikte. 36
Читать дальше