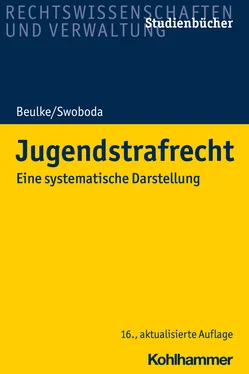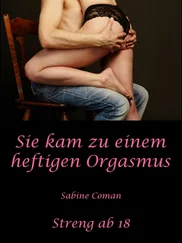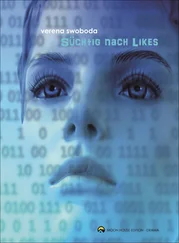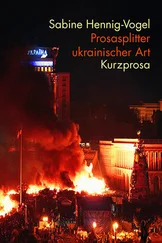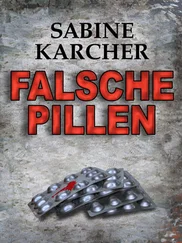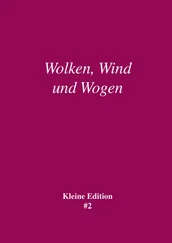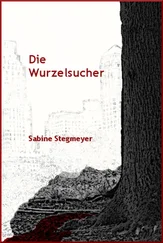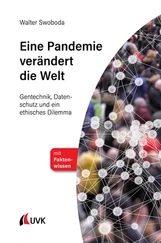3.Bandbreite der erzieherischen Sanktions- und Reaktionsmöglichkeiten im JGG
10Angesichts der im Jugendalter überwiegenden Kleinkriminalität (vgl. dazu Rn. 31 f.) wird es für eine Erziehung zur Legalbewährung regelmäßig ausreichen, dem Täter durch Ermahnungen oder einen leichten Denkzettel deutlich zu machen, dass die das soziale Verhalten regelnden Normen auch für ihn verbindlich sind und nicht ohne Nachteile für ihn selbst übertreten werden dürfen. Das geltende JGG sieht dafür eine reiche Palette von Möglichkeiten vor, die vom Absehen von jeder Sanktion (sog. Diversion) über Teilnahme an Täter-Opfer-Ausgleichsprogrammen, formlose Ermahnung, förmliche Verwarnung bis zu Arbeits- oder Geldauflagen und erzieherischen Weisungen reichen.
Bei ernsteren und insbesondere vielfach wiederholten Straftaten muss jedoch etwas anderes gelten. Diese Taten können Ausdruck schwerer Persönlichkeitsdefizite des jungen Menschen sein. Insoweit darf und muss sich die Erziehung auf eine positive Beeinflussung und Festigung der Persönlichkeit richten, die je nach Bedarf entweder in ambulanten (z. B. Bewährungsstrafe) oder stationären Formen (z. B. Heimerziehung/Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen/Jugendstrafvollzug) erfolgen kann.
11Das Ziel der Erziehung muss aber auch in den Fällen, in denen das Gericht besonders schwere Persönlichkeitsdefizite ausmacht, auf die Verhütung weiterer Straftaten des Täters beschränkt werden (vgl. § 2 I S. 1 JGG). Über den Rahmen strafrechtlicher Prävention hinausgehende staatliche Erziehungsbemühungen, beispielsweise unter Einschluss politischer oder weltanschaulicher Indoktrinationen, würden bei volljährigen „Heranwachsenden“ gemäß BVerfGE 22, 180 (219 f.) gleich mehrfach gegen das Grundgesetz verstoßen (z. B. als Verletzung der Rechte aus Art. 4 I GG oder Art. 5 I GG). 17Bei Minderjährigen würden sie darüber hinaus noch unzulässig in das in Art. 6 II GG verbürgte elterliche Erziehungsrecht eingreifen, das Vorrang vor dem staatlichen Erziehungsauftrag beansprucht. 18Wenn allerdings politischer Extremismus, Antisemitismus oder Ausländerfeindschaft Jugendlicher oder Heranwachsender Ursache schwerster Straftaten (z. B. Brandstiftung, Vandalismus oder gar Mord) sind, so wird eine spätere Legalbewährung nur erreichbar sein, wenn sich die Erziehung auch auf die Wurzeln dieser Hasskriminalität erstreckt. 19
II.Ursachen und Eigenart der Jugendkriminalität
12Die Besonderheiten des Jugendstrafrechts und seine Abspaltung vom allgemeinen Strafrecht werden gerechtfertigt durch die von den modernen Erfahrungswissenschaften vermittelten Einsichten in die Ursachen und die besondere Eigenart der Jugendkriminalität, deren wissenschaftliche Erforschung Gegenstand der Jugendkriminologie 20ist, sowie durch die besondere Bedeutung und die besonderen Möglichkeiten ihrer wirksamen Bekämpfung.
13Von echter „Kriminalität“ wird man bei den Bagatellstraftaten Jugendlicher und Heranwachsender kaum sprechen können. Sie stellen in den weitaus meisten Fällen harmlose, weil vorübergehende Entgleisungen dar, die in der Entwicklung fast jedes jungen Menschen mit der Einordnung in das soziale Leben verbunden sind. Wenn sie in den letzten Jahren so sehr in den Vordergrund der kriminologischen und kriminalpolitischen Diskussion getreten sind, so deshalb, weil sich die Zahl solcher Entgleisungen mit der Zunahme der Versuchungen im modernen Leben (Selbstbedienungsläden, Straßenverkehr u. dgl.), aber auch wegen der Lockerung im schwächer gewordenen Familienzusammenhalt erheblich erhöht haben dürfte. Deshalb erscheint die neuerdings verstärkt artikulierte Furcht vor vorzeitiger Kriminalisierung nicht unbegründet. 21
14Anders steht es mit der „echten“ Jugendkriminalität, worunter ihrem Unrechtsgehalt nach schwere Straftaten zu verstehen sind, aber auch solche mittelschweren Delikte, die wegen ihrer häufigen Wiederholung den Beginn einer kriminellen Karriere befürchten lassen. Zwar gelten auch hier für die Ursachen die allgemeinen Erkenntnisse der kriminologischen Forschung insoweit, als sie uns die Prägung der Täterpersönlichkeiten durch vielfach miteinander kombinierte Anlage- und Umwelteinflüsse zeigen. 22Diese Einwirkungen von Anlage und Umwelt, von denen jeweils bald die eine, bald die andere stärker ins Gewicht fällt und die sich auch nicht exakt voneinander trennen lassen, weil beispielsweise angebliche Anlagedefizite nur sekundäre Merkmale bestimmter Umwelteinflüsse sein können, gestalten in ihrem dynamischen Zusammenwirken die Persönlichkeit und heben die Freiheit der Willensentscheidung zwar nicht notwendig auf, begrenzen aber doch mindestens den ihr verbleibenden Spielraum. Auf das Vorhandensein eines solchen Spielraums gründet sich der Schuldvorwurf, der sich gegen die Entscheidung des Täters zum Verbotenen richtet, damit aber seine Fähigkeit zu einer entgegengesetzten Entscheidung voraussetzt.
15Aber in diesem allgemeinen Rahmen wird die kriminogene Situation des jugendlichen Täters durch gewisse spezifische Merkmale gekennzeichnet, die sie von der des Erwachsenen unterscheiden. Sie haben ihren Grund in der biologischen und soziologischen Eigenart des Jugendalters 23und lassen sich etwa unter folgenden Gesichtspunkten zusammenfassen:
1.Kriminalität als Ausdruck von Reifemängeln
16Der junge Mensch ist noch in allmählicher Entfaltung seiner Verstandes- und Willenskräfte begriffen. Deshalb übersieht er weder in gleichem Umfang wie der Erwachsene die tatsächlichen Folgen seines Tuns, noch sind ihm die in der Rechtsordnung statuierten Anforderungen eines geordneten Gemeinschaftslebens im gleichen Maße geläufig. Erst mit zunehmender Reife wächst er in die Welt der Erwachsenen hinein und passt sich ihren Maßstäben an. Dieser Lernprozess, den man mit dem Ausdruck „Sozialisation“ zu bezeichnen pflegt, ist ein langwieriger und hängt in seinen Fortschritten stark von den Einflüssen der Umgebung ab, insbesondere der Familie, in der das Kind bzw. der Jugendliche aufwächst. Deshalb fehlt es dem jungen Menschen oft noch ganz oder teilweise an dem für die strafrechtliche Verantwortlichkeit erforderlichen Unterscheidungsvermögen zwischen Recht und Unrecht. Daher haben schon die älteren Strafgesetze die Strafmündigkeit der Kinder und Jugendlichen beschränkt oder ganz ausgeschlossen. Doch erst in den letzten Jahrzehnten hat die Psychologie erkannt, dass sich neben der Verstandesreife auch die Fähigkeit zu rationaler Willenssteuerung erst allmählich entwickelt, laut Gehirnforschung dauert dieser Prozess bis zum 25. Lebensjahr. 24
2.Jugend als Zeit des Übergangs und der entwicklungsbedingten Spannungen
17Der Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein ist für den jungen Menschen eine Zeit besonderer innerer und äußerer Spannungen. Sie werden biologisch durch den Vorgang der Pubertät(Geschlechtsreifung), soziologisch durch die Notwendigkeit der „Anpassung an eine neue soziale Rolle“, 25eben die des auch gesellschaftlich und beruflich „Erwachsenen“ ausgelöst.
18a) Nach einem vorbereitenden Stadium der „Vorpubertät“ (bei männlichen Jugendlichen etwa mit dem 12. Lebensjahr, bei weiblichen schon früher beginnend) fällt bei der deutschen Jugend die eigentliche biologische Pubertät etwa in das Lebensalter von 14 bis 18 Jahren. Das jedenfalls ist die Altersbegrenzung, die seit dem Jugendgerichtsgesetz von 1923 dem gesetzlichen Begriff des „Jugendlichen“ zu Grunde liegt. Doch ebenso wenig wie die Pubertät plötzlich und unvermittelt beginnt, wird der biologische Reifungsvorgang übergangslos zu einem generell bestimmbaren Zeitpunkt abgeschlossen. Nicht nur, dass die Entwicklung bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer verläuft, vielmehr wird man ganz allgemein feststellen dürfen, dass pubertätsbedingte Verhaltensweisen in verschieden starkem Umfang auch noch in den folgenden Jahren (etwa bis in das 21. Lebensjahr, ja gelegentlich noch darüber hinaus) auftreten. Das deutsche JGG von 1953 hat dieser Erkenntnis Rechnung getragen, indem es in gewissem Umfang auch diese Altersstufe der „Adoleszenz “, d. h. in der Sprache des Gesetzes die „Heranwachsenden“, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres in das Jugendstrafrecht einbezogen hat.
Читать дальше