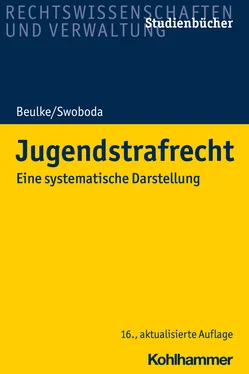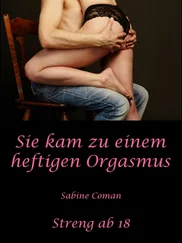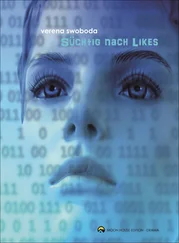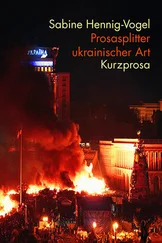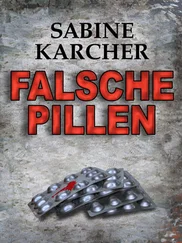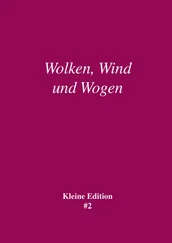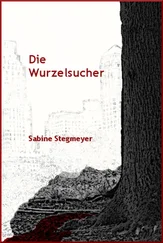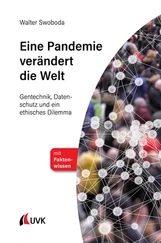155Die früher verstärkt geforderte Heraufsetzung des Strafmündigkeitsalters auf 16 Jahre wird heute nicht mehr ernsthaft diskutiert. Vielmehr hat sich auch in den meisten anderen Ländern Europas heute ein Altersmittel von 14 Jahren für den Eintritt der Strafmündigkeit durchgesetzt, der uns auch als angemessene Lösung erscheint. Leider haben sich aber auch die Forderungen, die bei Verfehlungen eines Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren nur Erziehungshilfen, nicht aber Jugendstrafe zulassen wollten, 280nicht durchsetzen können. Die praktische Bedeutung der Frage ist jedoch nicht allzu groß. Dass Jugendliche bereits im Alter von unter 16 Jahren zu einer Jugendstrafe verurteilt werden, kommt nur sehr selten vor, weil die Jugendrichter bei dieser jüngsten Altersgruppe im Anwendungsbereich des JGG ganz überwiegend nur bei wirklich begründetem Anlass und unter besonders sorgfältiger Prüfung ihrer Voraussetzungen zur ultima ratio der Jugendstrafe greifen. Typischer sind als Sanktionen für diese Altersgruppe jugendrichterliche Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel, darunter erforderlichenfalls Jugendarrest, der den Jugendgerichten oft auch schon bei 14- und 15-Jährigen angebracht erscheint.
II.Anwendung des JGG auf Soldaten
156Das JGG gilt grundsätzlich auch für Soldaten der Bundeswehr, die sich im Alter des Jugendlichen oder Heranwachsenden befinden, und zwar ohne Unterschied, ob ihre Taten „zivile“ oder militärische Delikte darstellen. Diese Soldaten sind also von den Jugendgerichten abzuurteilen, und die Rechtsfolgen ihrer Straftaten bestimmen sich nach den §§ 3–32 und 105 JGG. Allerdings enthält der 4. Teil des JGG (§§ 112a-112e), der durch das Einführungsgesetz zum Wehrstrafgesetz vom 30.3.1957 nachträglich in das JGG 1953 eingefügt worden ist, einige Abweichungen, die für die Dauer des Wehrdienstverhältnisses eines Jugendlichen oder Heranwachsenden gelten. Sie erklären sich aus den besonderen Bedürfnissen der militärischen Disziplin, zugleich aber auch aus der Notwendigkeit, die erzieherischen Maßnahmen des Jugendstrafrechts im Interesse ihrer Wirksamkeit der besonderen Lage des jungen Soldaten anzupassen. Aus diesem Grunde sind z. B. einzelne Rechtsfolgen des Jugendstrafrechts, die sich – wie die Hilfe zur Erziehung i. S. des § 12 JGG, also insbes. Heimerziehung und Erziehungsbeistandschaft – in ihrer Durchführung nicht mit dem Wehrdienstverhältnis vereinbaren ließen, auf Soldaten nicht anwendbar (§ 112a Nr. 1 JGG), während andere – wie die Bewährungshilfe und der Jugendarrest – den militärischen Verhältnissen entsprechend abgewandelt werden.
III.Der sachliche Anwendungsbereich des JGG
157Er ist dadurch bestimmt, dass die Anwendung des JGG eine „nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedrohte Verfehlung“ voraussetzt (§ 1 I JGG). Unter „Verfehlungen“ sind Verbrechen oder Vergehen zu verstehen. Sie müssen entweder durch das StGB oder durch ein nebenstrafrechtliches Gesetz (z. B. Steuer-, Wirtschafts- oder Wehrstrafgesetz), die vom JGG mit dem zusammenfassenden Ausdruck der „allgemeinen Vorschriften“ bezeichnet werden, mit echter Kriminalstrafe bedroht sein. Deshalb fallen Ordnungswidrigkeiten, die nach dem OWiG nur mit Geldbuße geahndet werden, und disziplinarrechtliche Tatbestände nicht unter das JGG.
158Für das Gebiet der ehemaligen DDR ist der Begriff „Verfehlungen“ ersetzt worden durch den der „rechtswidrigen Taten“. Gemeint sind damit alle rechtswidrigen Handlungen (Vergehen oder Verbrechen), die einen in der ehem. DDR geltenden Straftatbestand erfüllen. 281
159Bei Ordnungswidrigkeiteneines Jugendlichen oder Heranwachsenden gelten zwar grundsätzlich sowohl für die Rechtsfolgen (nur Geldbuße) wie für das Verfahren die Bestimmungen des OWiG (Verfolgung und Ahndung durch die zuständige Verwaltungsbehörde, bei rechtzeitigem Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ist jedoch eine Entscheidung durch Gericht erforderlich (§§ 67, 68 OWiG). Indessen wirken wesentliche Besonderheiten des Jugendstrafrechts auch in das Ordnungswidrigkeitsrecht hinein. Ein Jugendlicher handelt nur ordnungswidrig, wenn er nach seinem Reifestand die nach § 3 JGG erforderliche Einsichts- und Handlungsfähigkeit besitzt (§ 12 I S. 2 OWiG). Wird das gegen einen Jugendlichen oder Heranwachsenden festgesetzte Bußgeld nicht fristgerecht gezahlt, so kann der Jugendrichter unter den in § 98 I OWiG näher bezeichneten Voraussetzungen dem Jugendlichen auferlegen, Arbeitsleistungen zu erbringen, den Schaden wiedergutzumachen, bei einer Verletzung von Verkehrsvorschriften an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen oder sonst eine bestimmte Leistung zu erbringen. Bei schuldhafter Zuwiderhandlung gegen diese Anordnungen kann Jugendarrest (bei einer Bußgeldentscheidung nicht mehr als eine Woche) gegen ihn verhängt werden (§ 98 II OWiG). Zuständiges Gericht, das über den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid entscheidet, ist bei Jugendlichen und Heranwachsenden der Jugendrichter als Einzelrichter (§ 68 II OWiG). 282
160Das JGG befasst sich nur mit den strafrechtlichen Folgen der Verfehlungen Jugendlicher und Heranwachsender, indem es bestimmt, ob und unter welchen Voraussetzungen diese Verfehlungen Strafen oder andere jugendgerichtliche Maßnahmen nach sich ziehen. Die zivilrechtlichen Folgen der Jugendstraftat, insbesondere die Schadensersatzverpflichtungen gegenüber dem Verletzten, lässt es unberührt. Für sie gelten die allgemeinen Vorschriften der Zivilgesetze (insbesondere §§ 823 ff. BGB).
161Deshalb darf der jugendstrafrechtliche Begriff der Verantwortlichkeit (Strafmündigkeit) gem. § 3 JGG nicht mit dem zivilrechtlichen Begriff der Deliktsfähigkeit (§ 828 BGB) verwechselt werden. Beachte namentlich auch den Unterschied in den unteren Altersgrenzen der Verantwortlichkeit!
IV.Die subsidiäre Anwendung des allgemeinen Strafrechts
162Da das JGG nur die für Jugendliche und Heranwachsende geltenden Sonderbestimmungen enthält, greifen überall dort, wo sich eine solche Sonderregelung nicht findet, ergänzend die „allgemeinen Vorschriften“ des Strafrechts ein (§ 2 II JGG und § 10 StGB). Welches z. B. die Tatbestandsmerkmale eines Mordes, Diebstahls, Betruges oder einer Urkundenfälschung sind, das ergibt sich aus dem Besonderen Teil des StGB. Ebenso haben die Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe des allgemeinen Strafrechts sowie die Bestimmungen des StGB über Versuch und Teilnahme unbeschränkte Geltung auch für das Jugendstrafrecht.
163In der Literatur wird allerdings zunehmend gefordert, die Tatbestände des materiellen Strafrechts bei Anwendung auf Jugendliche „jugendadäquat“ auszulegen. Das Gebot einer „jugendadäquaten Auslegung“ lasse sich aus § 2 I S. 2 JGG ableiten. Der Erziehungsgedanke als grundlegendes Prinzip des Jugendstrafrechts müsse im gesamten Strafverfahren Anwendung finden, was auch die Auslegung der allgemeinen Vorschriften des StGB durch das Jugendgericht mit einschließe. Dadurch könne das tatbestandliche Unrecht bei Jugendlichen und Heranwachsenden anders als bei Erwachsenen zu bewerten sein. 283So seien z. B. die Straftatbestände zur Bandendelinquenz in §§ 244, 244a StGB teleologisch dahingehend zu reduzieren, dass die Tatbestände auf Jugendbanden keine Anwendung finden. Eine “jugendadäquate Gesetzesauslegung“ biete sich ferner für das Merkmal des „Erschleichens von Leistungen“ bei § 265a StGB oder für den Begriff der „Drohung“ in §§ 240, 241 StGB an. 284Auch bei den Rechtfertigungsgründen, insbesondere bei der rechtfertigenden Einwilligung in eine Körperverletzung, und im subjektiven Tatbestand bzw. bei der Feststellung von Fahrlässigkeitsunrecht müsse der Erziehungsgedanke bereits in die Auslegung des materiellen Strafrechts einfließen. 285Aus unserer Sicht lässt sich aus § 2 I S. 2 JGG jedoch kein Gebot einer „jugendadäquaten Gesetzesauslegung“ ableiten. Vielmehr stützt der Wortlaut in § 1 I JGG mit dem generellen Verweis auf die Normen des allgemeinen Strafrechts die Annahme des BGH, dass sich das Tatunrecht zunächst ausschließlich nach den Vorgaben des allgemeinen Strafrechts und der dafür geltenden allgemeinen strafrechtlichen Auslegungsgrundsätze bestimmt. Der jugendstrafrechtliche Erziehungsgedanke entfaltet erst im Strafverfahren und auf der Rechtsfolgenseite Wirkung. Die Tatbestände des StGB und des Nebenstrafrechts sind also zunächst nicht nach Sondermaßstäben zugunsten oder zulasten von Jugendlichen oder Heranwachsenden auszulegen. 286Nur im subjektiven Tatbestand und im Rahmen der Schuld ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass man es mit einem noch unreifen und lebensunerfahrenen Täter zu tun hat, der die Konsequenzen seines Handelns gegebenenfalls nicht in gleichem Maße überblickt wie ein Erwachsener.
Читать дальше