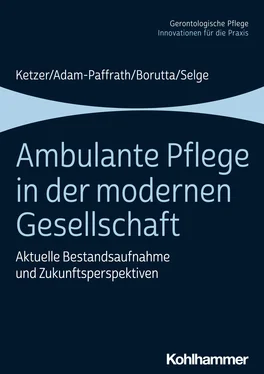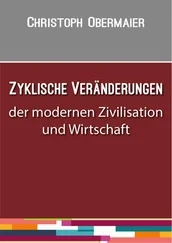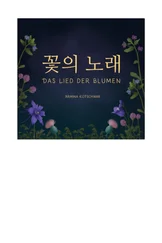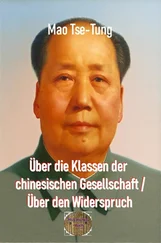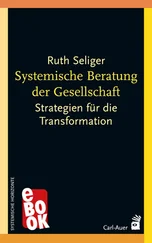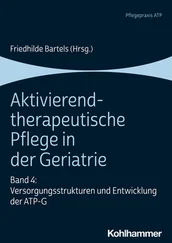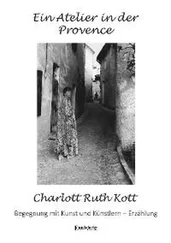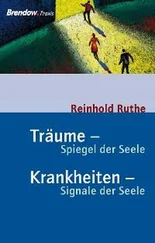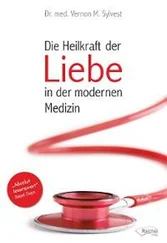Menschen verlassen ihren Herkunftsort, weil der Aufbruch in die Ferne faszinierend erscheint. Der Mensch ist ein Reisender und ein ortsgebundenes Individuum zugleich. Im globalisierten Raum kann er keine Heimat finden, die Lebenswelten werden größer unübersichtlicher und kälter (vgl. Barlmeyer 2013, S. 115). Für Joachim Klose ist das emotionale Beziehungsfeld Heimat eine Voraussetzung für gesellschaftlich verbindliche Normen. Gerade in Zeiten wachsender Globalisierungsprozesse mit den einhergehenden Modernisierungsprozessen, Entwurzelungen und Entfremdung wächst der Wunsch nach Regionalisierung. Unterschiedliche Entwicklungsgeschichten- und Geschwindigkeiten moderner Gesellschaften sowie die Individualisierung der Lebensbereiche lassen den Wunsch nach einer Bezogenheit auf einen Ort verständlich werden 5 . (vgl. Klose 2013, S. 12)
Martin Drenthen bezeichnet diese Tendenzen als »sentimentalen Rückzug aus der globalisierten Welt« hin zu einem neuen Regionalismus (vgl. Drenthen 2016, S. 147). Es geht um die Besonderheiten, die ein Ort zu bieten hat und in der aktuellen Umweltethik werden die Verwurzelungen, die Verbundenheit und Geborgenheit, die der Ort, an dem Menschen leben, diskutiert. Dabei ist der Begriff Ort (place) ein zentraler Begriff der Sozialgeologie, der in 1970er Jahren im Wesentlichen von Yi-Fu Tuan geprägt wurde. Ihm ging es um die Unterscheidung des abstrakten Begriffes Raum (space) zu dem persönlich erfahrenen und erlebten Ort (place). Der Ort umfasst nicht nur geografische Merkmale, sondern er beinhaltet auch die Wertvorstellungen, Gefühle, Lebensweisen und Identitäten der einzelnen Menschen.
»Space is abstract. It content; it is broad, open, an empty. Inviting the imagination to fill it with substance and illusion; it is possibility and beckoning future. Place by contrast is the past and the present stability and achievement« (Tuan 1975, S. 164).
Die Ethik des Ortes ist lange Zeit in der Umweltethik vernachlässigt worden. Man beschäftigte sich eher mit den Konsequenzen der Globalisierung für die Menschen. Es wird davon ausgegangen, dass der »globalisierte« Mensch eher eine abstrakte und objektive Einstellung zum Leben einnehmen soll. Dies bedeutet in der Folge, dass der Mensch ein universales Wesen ist, das eher körperlos und abstrakt nirgendwo in der Welt zuhause ist. Schaut man konkret in die heutige Arbeitswelt so wird deutlich, dass sich dieser Ansatz häufig im Bereich der Arbeitsplatzflexibilität, verbunden mit häufigen Ortswechseln, wiederfindet. Man kann von einer Art Entwurzelung und Trennung von Lebenswelten (privat/beruflich) des Menschen sprechen. Diese Denkweise vernachlässigt das Ortsgefühl (sense of place), das Menschen zu Orten aufbauen. Eine wesentliche Bedeutung, ob jemand sich wohlfühlt oder nicht, hängt davon ab wie sich das Ortsgefühl entwickelt. Der Ort als jeweils spezifische Topografie ist nicht von außen verhandelbar, er lässt sich nur schwer in politischen und gesetzlichen Prozessen abbilden. Dabei gibt es Einflussfaktoren, wie Landschaften, Nachbarschaft, Freundschaften, personengebundene geschichtliche Bezüge und damit verbunden eine tiefe Verwurzelung, die Jim Cheney als »storied residence« bezeichnet (Cheney 1989).
Untermauert wird obiger Ansatz der Bedeutung des Ortes für den Menschen mit der Aussage des Biologen Humberto Maturana: »Lebende Systeme sind Interaktionseinheiten. Sie existieren in einer Umgebung. Von einem biologischen Standpunkt aus können sie nicht unabhängig von jenem Teil der Umgebung verstanden werden, mit dem sie interagieren […]« (vgl. Maturana 2000, S. 26).
Die Bezogenheit des Menschen auf seine direkte Umwelt ist ebenso lebensnotwendig und zwar nicht nur im Sinne der somatischen Komponente, sondern auch gerade auf sein näheres Umfeld. Es geht hier um die Mensch-Umwelt- und im Folgenden weiter ausgeführt, die Mensch-Wohnung- und Umwelt-Passung.
2.3.1 Sense of Control – die Wohnung 6 (Habitat)
Die Wohnung als Habitat ist eine Kombination aus Biotop, gemeint ist hier die Tier- und Pflanzenwelt, und aus Psychotop als persönlichen Lebensraum mit der entsprechenden Ausgestaltung (vgl. Deinsberger 2007, S. 15). Es bedeutet, dass es sich hier um bestimmte Merkmale handelt, die eine Wohnung von anderen öffentlichen Räumlichkeiten unterscheidet. Eigene Gestaltungsmöglichkeiten, deren Veränderung und Regulation in der Wohnung sowie auch im abgegrenzten Freien, wie z. B. Garten oder Hof, unterliegt der Kontrolle der darin lebenden Menschen. Das Habitat bietet im Wesentlichen eine Schutzfunktion für Menschen ungeachtet von Geschlecht, sozialer oder kultureller Herkunft. (Deinsberger 2007)
Das Zuhause ist ein wichtiger Bestandteil der Kontinuität in der Lebenswelt des Ehepaars Meier. Diese Lebenswelt trennt das Leben draußen von dem Leben drinnen. Die äußere Lebenswelt erscheint in ihrer Komplexität immer schwieriger handhabbar, es muss eine Auswahl getroffen werden, zwischen dem was von draußen mit in die innere Lebenswelt genommen wird. Dabei spielen in diesen Entscheidungsprozessen die eigene Biografie, die Wertvorstellungen, die Notwendigkeit der Anerkennung von Fakten (z. B., dass für die Pflege des Ehepartners Unterstützung von außen benötigt wird) eine bedeutende Rolle.
Der Begriff »supported living« umschreibt zwar zunächst das Konzept der Unterstützung von Menschen mit Behinderung als einen Weg zur Selbstbestimmung, in der Differenzierung zwischen dem Zuhause und den Wohnheimformen jedoch gibt es deutliche Parallelen zu dem Fall Meier. Nach Christian Lindmeier (2001) ist das Zuhause das Zentrum der Lebenswelt von Menschen, egal ob mit oder ohne Einschränkungen. An diesem Ort wird alles organisiert, was innerhalb und außerhalb der Wohnung passieren soll. Menschen sind mit diesem Ort verwurzelt, emotional gebunden und sie haben die Möglichkeit jederzeit wieder an diesen Ort zurückzukehren. Gerade dieser letzte Aspekt ist für kranke und pflegebedürftige Menschen von enormer Bedeutung, denn wenn das Zuhause vorzeitig gekündigt oder verkauft wird, ist dies neben den Einschränkungen ein weiteres Verlusterleben, in der vulnerablen Lebenswelt der Betroffenen.
»Wohnst Du schon oder lebst Du noch?«, der Slogan des Möbelimperiums Ikea beschreibt die enge Verknüpfung zwischen Wohnen und Leben. Im englischen Sprachgebrauch wird diese Trennung zwischen Wohnen und Leben nicht vollzogen, »to live« bedeutet auch immer gleichzeitig wohnen. Es zeigt auch nach Heidrun Metzler und Christine Richter, dass Menschen eben mit dem Wohnen mehr verbinden als nur ein »Dach über dem Kopf« und der Aspekt der Lebensqualität eine Rolle spielt (Metzler und Richter 2004). Das Zuhause als privater Rückzugsort schafft eine gewisse Art von Freiheit, die je nach persönlichem Bestimmungs- und Autonomiegrad einer Art öffentlich-sozialer Norm unterliegt. In den »eigenen vier Wänden« finden Handlungen und Gedanken, Rollenzwänge, Emotionen ihren Platz. Diese individuellen Vorstellungen von Geborgenheit und Sicherheit können in verschiedenen Formen zum Ausdruck kommen. Die Wahl des Einrichtungsstils, die Anordnung der Möbel, Bilder, bevorzugte Farben gehören zu der Wohnindividualität der Personen 7 .
Der Aspekt der Selbstbestimmung spielt beim Wohnen eine gewichtige Rolle. Der Mensch möchte selbst entscheiden, wer in seine Wohnung kommt, welche Kontaktformen er zu anderen Menschen hält oder wann er der Außenwelt Zutritt gewährt und wann nicht. Es handelt sich letztendlich um eine gelungen Balance zwischen Individualismus und Kollektivität. Diese Balance liegt zwischen unterschiedlichen Lebenszyklen, wie z. B. alleine leben, Partnerschaft, Familie, Auszug der Kinder, Ruhestand etc. Diese Wandlungsprozesse innerhalb des Lebens werden in der Wohnung und in der vertrauten Örtlichkeit gelebt. Selbstverständlich ist ein solch beschriebener Lebenszyklus nicht störungsfrei, er unterliegt Brüchen, wie Trennungen, Tod oder Wegzug. Aber selbst dann unterliegen eine Wohnung und der ausgewählte vielleicht (neue) Wohnort bestimmten Schutzmerkmalen, die nahezu universell sind. Deinsberger (2007) nennt hierzu folgende Merkmale:
Читать дальше