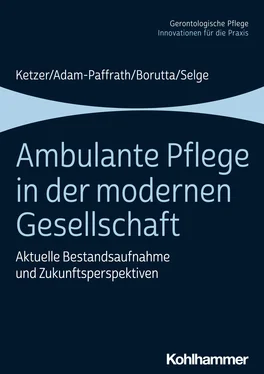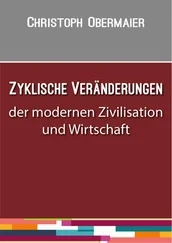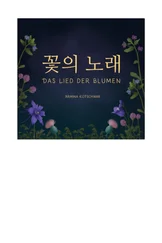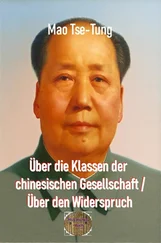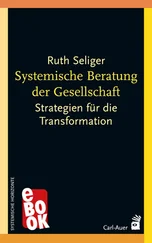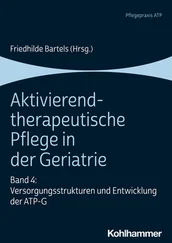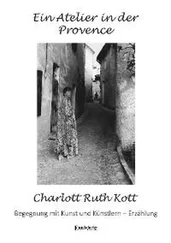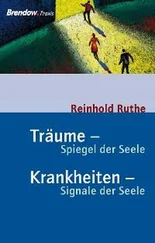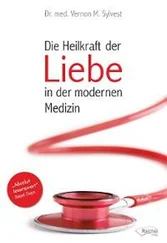2Die Einleitung wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ingo Bode verfasst.
2 »Ich möchte zuhause gepflegt werden« Sozialwissenschaftliche und anthropologische Perspektiven auf die Ethik des ambulanten Arbeitsbereiches
Renate Adam-Paffrath
Im ersten Teil wird eine sozialwissenschaftliche und anthropologische Perspektive auf die Ethik des ambulanten Arbeitsbereichs entfaltet. Pflege zuhause ist nicht mehr nur eine Privatangelegenheit der Betroffenen. Sie unterliegt vielmehr gesellschaftlichen komplexen Einflüssen. In einer philosophisch-ethischen Perspektive wird der ambulante Arbeitsbereich mit Hilfe eines kurzen historischen Überblicks beobachtet: Wie wurde das, was wir vorfinden zu dem, wie es sich darstellt? Die Relevanz des Umfeldes, in dem ambulante Pflege sich vollzieht, wird verdeutlicht über die Begriffe Heimat, Ort und Wohnung vor einer philosophischen Perspektive anhand von zwei Weltbildern (Descartes und Heidegger) hin zu den ethischen Zusammenhängen zwischen Mensch, Umwelt, Pflege und Gesundheit. Chronisch kranke und alte Menschen zuhause pflegen bedeutet oft, dies über einen längeren Zeitraum zu tun. Dabei sind die Rolle bzw. der Status der Pflegenden, die von außen in den privaten Bereich (bspw. des Ehepaars Meier) hineinkommen, nicht immer eindeutig geklärt. Kommen sie als Gast ohne Einladung und ohne Gastgeber in den Haushalt und den Privatbereich der zu Hause lebenden auf Pflege angewiesenen Menschen? Unterschiedliche Abhängigkeitsmuster, chronische Überlastungserfahrungen, die bis zur Ausbeutung gehen können durch die Erwartungshaltungen der Familien forciert werden. Die (Angst um die) Finanzierung des (bezahlbaren) Umfangs der Pflege laufen beständig als Determinanten im Hintergrund mit und wirken sich auf die Interaktionsebene zwischen Angehörigen, pflegebedürftigen Menschen und Pflegefachkräften aus. Ambulante Pflege vollzieht sich innerhalb der Wohnung, als Habitat der pflegebedürftigen Menschen. Sie stellt gleichermaßen ein Biotop und ein Psychotop als persönlichen Lebensraum dar. Das Zuhause ist ein wichtiger und für pflegebedürftige Menschen zunehmend wichtiger werdender Bestandteil der Kontinuität in der Lebenswelt – auch des Ehepaars Meier. Es ist als privater Raum – mit Hannah Arendt gesprochen – der Gegenentwurf zum öffentlichen Raum. Von den nahezu 2,6 Mio. Menschen, die zu Hause gepflegt werden (76 % aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland), werden 1,76 Mio. Menschen ausschließlich von ihren Angehörigen mit gepflegt. Weitere 830.000 pflegebedürftige Menschen (32 % aller pflegebedürftigen Menschen, die zuhause leben) erfahren Unterstützung durch ambulante Dienste (Pflegestatistik 2017). Der Einfluss politischer und gesellschaftlicher Vorstellungen zu Art und Weise, wie die Pflege zuhause zu sein hat, hat seit Einführung der Pflegeversicherung (Mitte der 1990er Jahre) stark zugenommen. Im Beitrag wird dies anhand der vier Metaparadigmen Person, Umwelt, Gesundheit und Pflege verdeutlicht, um das Wirkgefüge auf das Ehepaar Meier zu veranschaulichen. Die philosophisch-ethische Perspektive auf Sorge und Fürsorge und damit einhergehende Fragen von Abhängigkeit und Unabhängigkeit des Menschen werden über den Begriff der Care-Ethiken (n. Uzarewizc & Uzarewizc 2005) analytisch entfaltet. Dabei geht es um die Beziehung von Menschen zueinander und gleichermaßen um die fürsorgliche Haltung gegenüber Menschen. Die neun Thesen von Conradi (2001) veranschaulichen die verschiedenen Dimensionen des Begriffs Care, der zum einen eine aktive und handelnde Seite zutage fördert und zum anderen einen deutlich interaktiven Aspekt aufweist. Denn in den Interaktionen zwischen den in der Pflege Beteiligten können Machtverhältnisse unterschiedlicher Art entstehen und beobachtet werden. Die unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven, die der Beitrag aufgreift, ermöglichen eine der Komplexität des Handlungsfeldes angemessene mehrdimensionale Betrachtungsweise. Dabei wird erkennbar, dass der ambulante Bereich kein Stiefkind oder billiger Ersatz des stationären Sektors ist, sondern eine wichtige Säule des Gesundheitswesens, die zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.
Stichwörter: Dasein, Umweltethik, Heimat, Care-Ethik, Pflegetheorien
In dem folgenden Beitrag wird eine Konturierung des ambulanten Arbeitsbereiches aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen und anthropologischen Perspektiven vorgenommen. Der ambulante Arbeitsbereich rückt seit der Einführung der Pflegeversicherung und angesichts des demografischen Wandels immer mehr in das öffentliche Bewusstsein. Das Thema »Pflege zuhause« ist nicht mehr nur die Privatangelegenheit der betroffenen Familien, sondern in den letzten Jahren ebenso eine politische Herausforderung. Die Steuerung der Pflege zuhause unterliegt komplexen Einflüssen. Möglichkeiten, Chancen, Probleme und die daraus resultierenden Konsequenzen werden in diesem Beitrag an dem Fallbeispiel des Ehepaars Meier erörtert. Dabei werden Erkenntnisse aus den umweltethischen, philosophisch-ethischen sowie exemplarische Theorien der Pflege hinzugezogen. Im ersten Teil des Beitrages geht es zunächst um die Betrachtung des ambulanten Arbeitsbereiches mit einem kurzen historischen Überblick.
Im Anschluss daran wird der Ort, an dem die Pflege stattfindet, einer näheren Betrachtung unterzogen. Dabei gehe ich mit den Begriffen Heimat, Ort, Wohnung, von der These aus, dass es gerade für die ambulante Pflege nicht unerheblich ist, in welchem Umfeld die Versorgung von Patienten stattfindet.
Die philosophische Perspektive dient dazu exemplarisch an den Weltbildern von René Decartes (1596–1650) und Martin Heidegger (1889–1976) das Verhältnis des Menschen in der Welt darzustellen. Ausgewählte Care-Ethikerinnen sowie Pflegetheoretikerinnen erweitern den Blickwinkel um die ethischen Zusammenhänge zwischen Mensch/Umwelt/Pflege/Gesundheit.
Der Abschluss des Beitrages bildet eine kritische Auseinandersetzung mit den im Beitrag verwendeten Begrifflichkeiten.
2.2 Pflege zuhause – Betrachtungen auf ein komplexes Feld
Zunächst ein kurzer Rückblick. Die Pflege zuhause hat eine lange Tradition. Noch bevor es Krankenhäuser gab, pflegten Familienangehörige (meist Frauen) Kinder oder Großeltern zuhause. Im 17. Jhd. begründete Vinzenz von Paul in Frankreich die Organisation der Barmherzigen Schwestern, die Kranke in ihren eigenen Wohnungen betreuten (Seidler 1980). Im Jahr 1836 gründete Theodor Fliedner in Kaiserswerth den evangelischen Verein für christliche Krankenpflege. Fliedner wollte zunächst höhere Töchter und Pastoren- und Arzttöchter ausbilden. Krankenpflege wurde jedoch zu dieser Zeit von den unteren sozialen Schichten, z. B. von Dienstboten oder Dienstmädchen ausgeführt (Kreutzer 2005). Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert kam die industrielle Revolution und damit die Entstehung des »dritten Sektors« des Non-Profit-Bereichs.
Durch die Industrialisierung entstanden soziale Probleme in den übervölkerten Städten, es gab keine Betreuung von vulnerablen Randgruppen, wie Kinder, Alte und Kranke, Prostituierte. Die arbeitende Bevölkerung war mit vielen Seuchen und Verwahrlosungen aufgrund von mangelnder Hygiene konfrontiert. Es entstanden die ersten Ansätze von Frauen- und Wohlfahrtsverbänden (DRK, Caritas, Diakonie) sowie die innere Mission (Kramer, Eckart, Riemann 1988). Das soziale Feld war eine der wenigen Möglichkeiten für Frauen zu arbeiten, da sie keinen Zugang zur männlichen Arbeitswelt in den Fabriken oder für ein Studium in Universitäten bekamen. Unverheiratete Frauen hatten die Möglichkeit in Ordensgemeinschaften einzutreten.
Im Nationalsozialismus hatten die NS-Gemeindeschwestern den Auftrag, nationalsozialistisches Gedankengut in die Bevölkerung zu bringen (Steppe 1996). Der Schwerpunkt der Arbeit war die Förderung der Volksgesundheit (Arbeit am »Volkskörper«). Die nationalsozialistisch eingebundenen Gemeindeschwestern konnten nach dem 2. Weltkrieg in den westlichen Besatzungszonen in traditioneller Weise weiter arbeiten. Bis in die 1960iger Jahre war die ambulante Pflege von christlichen Ordensgemeinschaften dominiert. Die traditionelle Gemeindeschwester starb jedoch aufgrund des Mangels an Nachwuchs allmählich aus (Brunen & Herold 2001). Es entstand der erste Pflegenotstand. Jens Alber sprach in diesem Zusammenhang von einem »katastrophalen Schwesternmangel« (Alber 1990). Das Thema des Schwesternmangels erreichte auch die Politik und es wurde erstmals über die Absicherung des Pflegerisikos diskutiert (Meyer 1996, Rothgang 1997, Adam-Paffrath 2008). Aus dieser Notlage heraus wurde nach über 20 Jahren politischen Verhandlungen 1995 die Pflegeversicherung eingeführt.
Читать дальше