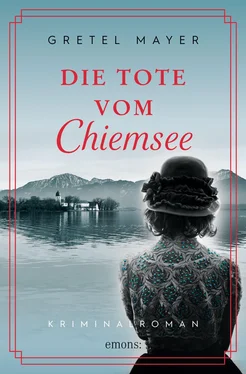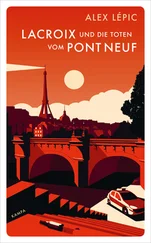»Guat hast’n wieder hergricht«, lobte die Agnes. »Sie müssen wissen, Frau von Lindgruber, dass der Hut schon seit vier Generationen in unserer Familie ist. Was der schon alles mitgmacht hat! Und die Fanny, müssen S’ wissen, ist die Großnichte von der Huaterer-Nanni. Die Huaterer-Nanni aus Prien hat den Hut nämlich erfunden. Zuerst war’s a Strohhut, mit dem hat sie in Berlin a Medaille errungen; erst später sind dann der Hasenfilz, die goldenen Borten, die Quasten und die Goldstickerei dazugekommen. Die Chiemgauerinnen tragen den Hut seit Anfang des Jahrhunderts, und nachdem die Weiberleut seit 1920 auch in den Trachtenvereinen dabei sein dürfen, ist er sehr bekannt geworden. Sie sollten sich mal den Hut von der Luise Riedinger anschaun. Die hat im Dorf den schönsten!«
Franzis Begeisterung und Tatendrang waren geweckt. Ihr spukten bereits so einige Ideen durch den Kopf: Man könnte doch zum Beispiel die Hüte der Stadtfrauen mit Accessoires des Priener Hutes kombinieren, ohne dass gleich ein richtiger Trachtenhut dabei herauskommen müsste. Es wurde vereinbart, dass die Luise Riedinger mit ihrem Hut in den nächsten Tagen bei Franzi vorbeischauen sollte, Therese würde ihr Bescheid geben.
Auf dem Nachhauseweg fühlte Franzi sich richtig beschwingt. All ihre Sorgen waren mit einem Mal wesentlich kleiner geworden.
»Ich glaub, aus dieser Wirtschaft kommen wir heut gar nicht mehr raus«, stöhnte Benedikt. »Außer dem Alfred müssen wir ja auch noch die zwei Weibsleut einvernehmen.«
»Wir könnten sie natürlich auch aufs Revier bestellen«, meinte Fanderl. »Aber das hab ich auch von dir glernt, dass es immer gscheiter ist, die Leut in ihrer gewohnten Umgebung zu befragen, da reden s’ mehr. Außerdem ist’s hier einfach gemütlicher.«
Daher baten sie den Wirt, nun seine Frau und die Tochter bei ihnen vorbeizuschicken. Der Alfred sollte erst gegen zwei Uhr mittags vom Schlachthof zurückkommen.
Die beiden Habegger-Frauen nahmen widerwillig am Tisch Platz, eine schaute griesgrämiger als die andere.
»Frau Habegger, Sie haben die Flora ja auch gekannt. Erzählen Sie doch ein wenig über sie«, begann Benedikt die Befragung.
Wie sich herausstellte, war Frau Habegger keine Freundin vieler Worte. »Ja, kennt hab ich sie, mögn hab ich sie nicht«, antwortete sie kurz und bündig, schlug den Blick nieder und knetete ihre Hände.
Benedikt seufzte innerlich auf. »Flora war eng mit Ihrem Sohn Theo befreundet. Was haben Sie davon gehalten?«
»Nix. Die hat hier ned neipasst.«
»Wieso?«
»A Stadtmadl war s’, a Theatermensch und a Kommunistin no dazu!«
»Ihr Sohn Alfred hat das auch nicht gutgeheißen?«
»Na!«
Benedikt gab auf und wandte sich an Lisi Habegger. Sie rieb und knetete den Irmengard-Anhänger, der an ihrer schmalen Brust baumelte.
»Die war nie in der Kirch, nie hod s’ a Gebet gsprochn. Sogar d’Abendandacht drüben im Kloster hat s’ immer gschwänzt! Die hod an nix glaubt! Die war mit die Roten und mitm Teufel im Bund! Sie war a Hex!«, brach es aus Lisi heraus.
»Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie oft in der Kirch?«, fragte Benedikt.
Lisi Habegger nickte eifrig. »Seit die selige Irmengard mich gerettet hat …«, begann sie eifrig, doch Fanderl schnitt ihr das Wort ab.
»Ja, die Gschicht kennen wir schon, Lisi.«
Lisi schaute beleidigt und schien entschlossen, kein Wort mehr zu sagen. Ihr ohnehin schon schmaler Mund wurde zum Strich.
Abschließend bestätigten die Habegger-Frauen, der Wirt und die Bedienung Elsi, die gerade gekommen war, noch, dass der Theo den ganzen Abend bis spät in die Nacht hinter der Theke gestanden hatte. Sie selbst seien entweder in der Küche, ebenfalls hinter dem Tresen und in der Bedienung gewesen. Alle bis spät in die Nacht.
»A paar Hockableiba warn halt da«, erklärte der Wirt abschließend.
»Jetzt vertreten wir uns die Füß, bis der Alfred kommt«, schlug Fanderl vor, und sie traten vor die Wirtschaft. Es waren kaum mehr Wolken am Himmel, ein leichter frischer Wind wehte, der See, auf dem nun wieder Schiffsverkehr war und sogar ein einsames Segelboot kreuzte, glänzte samtblau, und beiden Männern kamen der dichte Schneefall und der heftige Sturm fast wie ein Traum vor.
»Was ist denn das für eine Geschichte mit der Lisi und der Irmengard?«, fragte Benedikt.
»Oh mei«, meinte Fanderl, »i war ja selber dabei. Des dürft schon bald zwanzig Jahre her sein, mir warn alle noch Kinder. Jedenfalls war der See zwischen Dorf und Insel damals fest zugfrorn. Des war natürlich a großer Spaß für uns. Wir sind den ganzen Tag mit die Schlittschuh und die Schlitten rumgrutscht. Die Lisi war auch dabei.«
Als es dann dunkel wurde, erzählte Fanderl weiter, hätten die Eltern die Kinder nach Hause gerufen, und da sei aufgefallen, dass die Lisi fehlte. Sofort seien alle mit Lichtern und Lampen ausgeströmt und hätten nach ihr gesucht. Es habe wohl schon einige Zeit gedauert, aber dann habe die Gruberin sie gefunden. Offenbar sei die Lisi in der Dunkelheit aus Versehen nicht zum Dorf, sondern in Richtung der Insel gegangen und unterwegs so unglücklich auf den Kopf gestürzt, dass sie das Bewusstsein verloren habe. Und weil die Gruberin einen hellen Fellmantel angehabt und eine Lampe in der Hand getragen habe, sei die Lisi, wie sie wieder zu sich gekommen sei, fest davon überzeugt gewesen, dass die selige Irmengard mit ihrer Kerze sie gerettet habe. Seit diesem Vorfall sei die Lisi ein wenig seltsam. Sie habe sich auch seit damals nicht mehr weiterentwickelt, sie sei heute noch wie ein Kind, und es gebe für sie nichts anderes als die Irmengard und ihren geliebten Bruder Alfred, dem sie jede Meinung nachplappere und jeden Wunsch von den Augen ablese.
»Aber mit dem Tod von der Flora wird sie wohl nichts zu tun haben«, meinte Benedikt, »dazu ist sie doch zu schwächlich und zu unselbstständig.«
Fanderl zuckte die Achseln. »Die ist zäher, als man denkt. Ich könnt mir schon vorstellen, dass sie aus hündischer Liebe zu ihrem großen Bruder zu so was fähig wäre. Doch sie war ja auch den ganzen Abend in der Wirtschaft.«
Fanderl stockte und zeigte zum Seeweg. »Schau mal, Benedikt, da kommt doch dei Frau!«
Und tatsächlich kam ihnen auf dem Seeweg der kleine Einspänner entgegen, der im Besitz der Familie von Lindgruber war und sicher schon fünfzig Jahre auf dem Buckel hatte. Elegant, im grauen Kostüm und ein grünes Hütchen mit Feder auf dem Kopf, fuhr Franzi ihnen entgegen, und es sah aus, als hätte sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht als einen Einspänner zu lenken. Sie stoppte das Gefährt formvollendet vor ihnen und rief: »I komm grad von der Therese!«
»Da habt ihr wahrscheinlich sauber geschimpft auf eure zwei Polizisten«, meinte Benedikt.
Franzi schüttelte den Kopf. »So wichtig seids ihr zwei jetzt auch wieder nicht. Nein, wir haben einen Hut angeschaut, einen Priener Hut, ich kann euch sagen …«
»Das erzählst du mir dann heut Abend daheim«, fiel ihr Benedikt ins Wort, der ungeheuer erleichtert war, seine Franzi wieder guter Dinge zu sehen.
Und was hat zum Stimmungswandel beigetragen? Ein Hut, was sonst, dachte er und musste innerlich schmunzeln.
Franzi setzte ihren Weg fort, und Fanderl und Benedikt gingen zurück in den Seewirt. Alfred war inzwischen heimgekehrt; er lehnte, ein Glas Bier in der Hand, an der Theke und schaute ihnen mit herausforderndem Blick entgegen. Unter seiner Schankschürze wölbte sich ein für sein jugendliches Alter beachtlicher Bauch, die obersten beiden Hemdknöpfe standen offen und zeigten seinen enorm kurzen dicken Hals.
»Heil Hitler, die Herren!«, rief er.
Fanderl und Benedikt murmelten etwas, und man machte sich auf in die Nebenstube, um ungestört zu sein. Dabei lief mit hochrotem Kopf die Lisi an ihnen vorbei, steckte einen Zettel in ihre Schürzentasche und rief devot: »Bin scho unterwegs, Alfred. Geht alles in Ordnung!«
Читать дальше