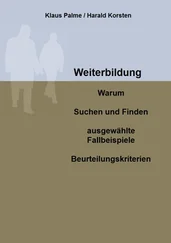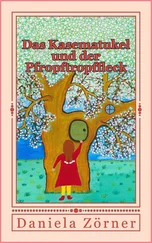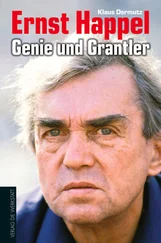Klaus Dörner - Bürger und Irre
Здесь есть возможность читать онлайн «Klaus Dörner - Bürger und Irre» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bürger und Irre
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bürger und Irre: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bürger und Irre»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bürger und Irre — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bürger und Irre», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das Buch hat also ein Alter erreicht, in dem es selbst schon institutionelles Gepräge hat. Vielleicht ist das Bild des »Bergwerks« besser, in das getrost Wissenschaftler aller Art einfahren können, weil sie etwas für die Selbstaufklärung ihrer Wissenschaft Brauchbares finden werden, wobei sie je nach dem Jahrzehnt ihres Einfahrens etwas anderes als brauchbar wahrnehmen werden. Im folgenden werde ich drei solcher Fundstücke, also drei Facetten der Wirkgeschichte von »Bürger und Irre«, breiter darstellen, weil sie mir für Gegenwart und Zukunft besonders wichtig sind. Es handelt sich einmal um das Verhältnis von Romantik und Aufklärung, zum anderen um die psychiatrische Reformbewegung nach 1945 und schließlich um die Integration der NS-Psychiatrie in die Geschichte der Moderne.
1.
1994 erschien ein Buch des amerikanischen Germanisten Th. Ziolkowski mit dem Titel »Das Amt des Poeten – die deutsche Romantik und ihre Institutionen« (München), das sich nicht zuletzt auch auf »Bürger und Irre« bezieht. Ziolkowski weist nach, daß die deutschen Romantiker durchaus in der gesellschaftlichen Realität ihrer Zeit standen, diese gestalteten und in ihrer Poesie das intellektuelle Modell einer Reihe von Institutionen schufen, ohne deren systematische Wirksamkeit die Moderne nicht denkbar wäre. Er macht dies an den Institutionen Bergwerk, Justiz, Irrenhaus, Universität und Museum fest, denen er die Naturwissenschaften, die Gesellschaftswissenschaften, die Psychologie, die Philosophie und die Kunst zuordnet. In einer Zeit, in der auf der Basis des Selbstbestimmungsrechts des Individums und einer utilitaristischen Ethik die Marktwirtschaft begann, die Gesellschaft zu atomisieren, standen – so Ziolkowski – die Romantiker poetisch wie beruflich für die Modernisierung von Institutionen, durch die die Individuen sich dennoch weiterhin als Teil eines Ganzen sehen konnten. In diesem Kontext steht das Irrenhaus für die sich damals bildenden flächendeckenden Netze sozialer Institutionen, in denen nicht nur die psychisch Kranken, sondern insgesamt etwa die 10% der Bevölkerung institutionalisiert werden konnten, die gegenüber der modernen bügerlichen Vernunft als unvernünftig galten und die mangels bürgerlicher Wohlanständigkeit und industrieller Verwertbarkeit im Prozeß der Vermarktwirtschaftlichung ohne gesellschaftlichen Ort und Sinn und damit rettungslos verloren gewesen wären. Die Analyse Ziolkowski stützt die Position, daß es zu Beginn der Moderne zur Institutionalisierung störender, gestörter und unbrauchbarer Bevölkerungsgruppen keine Alternative gab. Zugleich ist sie ein Beleg dafür, daß die Wirtschaftsbürger und die Bildungsbürger, also die Repräsentanten der beiden Spaltprodukte der vollständigen aufklärerischen Vernunft, nämlich der instrumentellen Individualvernunft und der romantischen Sozialvernunft, getrennt voneinander, aber komplementär und gleichsinnig die moderne Gesellschaft gestaltet haben. Diese Überlegungen könnten sich unmittelbar dazu eignen, in der heutigen Kontroverse zwischen Liberalismus und Kommunitarismus zu einem tragfähigen Kompromiß zu kommen.
2.
Die Wirkung von »Bürger und Irre« auf die Praxis, insbesondere auf den begeisterten Beginn der psychiatrischen Reformbewegung, der Aufhebung der Ausgrenzung der Unvernunft, der De-Institutionalisierung der psychisch Kranken in Deutschland wie in den anderen europäischen Ländern liegt auf der Hand, zumal nicht zuletzt vom Geist der antiautoritären Bewegung der 68er Jahre getragen. So hat Franco Basaglia mir mehrfach gesagt, welch große Bedeutung »Bürger und Irre« für die Entstehung der Bewegung der »Demokratischen Psychiatrie« in Italien gehabt hat. Gegenüber der Neigung kontinentaleuropäischer Nabelschau hat das Buch aber auch nachgewiesen, daß der Beginn der Psychiatrie als Institution und Wissenschaft und damit der Beginn der Ausgrenzung der Unvernunft im Rahmen des Beginns der Moderne nicht in Mitteleuropa, auch nicht im revolutionären Frankreich – mit Pinel –, sondern in England zu suchen ist. Dem entspricht, daß nach 1945 wiederum in England mit der Psychiatriereform, der Emanzipation der psychisch Kranken von der Ausgrenzung, ihrer De-Institutionalisierung begonnen wurde. Insofern war in den 70er Jahren mit Recht England das Mekka aller europäischen Reformbegeisterten. Auch in der Verwirklichung der Reform hat England bis heute den Vorsprung halten können: Nur in diesem Land sind heute immerhin von 130 psychiatrischen Großkrankenhäusern, »Anstalten«, 40 vollständig aufgelöst worden.
Was man damals noch nicht wissen, allenfalls ahnen konnte, da die Begeisterten zu wenig Abstand von ihrem eigenen Handeln hatten, war die Wahrnehmung der Tatsache, daß die Psychiatriereform nur ein kleines, wenn auch bedeutendes Segment der allgemeinen sozialen De-Institutionalisierung darstellt. Auch hier war »Bürger und Irre« hilfreich, da das Buch nachweist, daß die Ausgrenzung der psychisch Kranken nur im Rahmen der Ausgrenzung aller industriell Unbrauchbaren und Störenden zu sehen ist, im Rahmen ihrer Institutionalisierung als Beantwortung der »Sozialen Frage«, während nach 1945, also nach Ende des NS-Regimes, weltweit alle marktwirtschaftlich-industriell entwickelten Gesellschaften ihre bisherige Institutionalisierungspolitik zunehmend durch eine De-Institutionalisierungspolitik ersetzten, durch eine Bewegung der zunehmenden Integration aller bisher ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen. Dies erfolgte in allen Ländern in derselben Reihenfolge: es begann mit den Körperbehinderten und der Jugendhilfe, setzte sich fort mit den geistig Behinderten und erfaßte erst später die psychisch Kranken. Dieser zunehmenden Integrationsbereitschaft der Gesellschaft entsprach die Fähigkeit der Betroffenen, sich in Selbsthilfeinitiativen zu organisieren und zu emanzipieren: erst die Körperbehinderten, dann die geistig Behinderten (über ihre Eltern, etwa in der »Lebenshilfe«), dann die Angehörigen psychisch Kranker (seit den 80er Jahren mit einem eigenen Bundesverband) und schließlich die psychisch Kranken selbst (seit den 90er Jahren mit ihrem »Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrenen«). Heute ist daraus die Bewegung der trialogischen Psychiatrie oder der Trialog-Foren geworden – als Bewegung von Vertretern autonomer Gruppen auf derselben Ebene: Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige psychisch Kranker und psychiatrische Profis. An dieser Stelle ist »Bürger und Irre« weiterzudenken: denn die Institutionalisierung im 19. Jahrhundert ist auch als innere Kolonisierung der unbrauchbaren Bevölkerungsgruppen zu sehen und findet damit Anschluß an die beiden anderen den Beginn der Moderne kennzeichnenden Kolonisierungsprozesse, die äußere Kolonisierung des nicht-industriellen Restes der Welt und die Kolonisierung der Natur. Nach 1945 entspricht in allen drei Richtungen der De-Institutionalisierung die Entkolonisierung auf der Basis der Selbsthilfe und der Emanzipation der bisher Ausgebeuteten. Dies sind weltweit gleichsinnige Prozesse, die sich auch wechselseitig fördern können. Nicht daß die Entkolonisierung die Kolonisierung abgelöst hätte; dies anzunehmen wäre unhistorisch. Vielmehr sind die modernen Kolonisierungsbestrebungen der markwirtschaftlichen, instrumentellen Individualvernunft weiterhin wirksam. Aber neben diese sind die ebenso wirksamen Entkolonisierungsbestrebungen der romantischen (?) Sozialvernunft getreten und nehmen trotz ständiger Rückschläge an Wirksamkeit bis heute zu.
Noch einmal zurück zur Psychiatriereform. Die Geschichte der Psychiatrie ist voller Reformen, zeigt aber auch, daß reformerische Begeisterung verpufft, wenn sich deren Energie nicht in jahrzehntelanges geduldiges Bohren harter Bretter stecken läßt. »Bürger und Irre« zeigt, warum das so ist und so sein muß. Die Ausgrenzung der Unvernunft, die Institutionalisierung der marktwirtschaftlich-industriell nicht verwertbaren Bevölkerungsgruppen als Antwort auf die »Soziale Frage« war im Aufbruch zur Moderne offenbar eine gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit, eine Problemlösung, an der alle geistigen, kulturellen, ökonomischen, sozialen und politischen Bereiche der Gesellschaft beteiligt waren und durch die alle diese Bereiche verändert, modernisierbar wurden. Diese Problemlösung hat für 150 Jahre, von 1800 bis 1950, die Modernität der Gesellschaft garantiert. Allein daraus ergibt sich schon, daß die Bewegung der De-Institutionalisierung alle Bereiche der Gesellschaft berühren und verändern muß, bis sie nicht mehr modern, sondern vielleicht postmodern sind. Dabei ist aber eine unvollständige De-Institutionalisierung sinnlos: Die Institutionen würden sich wieder vervollständigen. In Betracht kommt nur eine vollständige De-Institutionalisierung, also eine vollständige Wiederherstellung der Begegnungsmöglichkeiten von Vernunft und Unvernunft, von Vernünftigen und Unvernünftigen, wobei das Rad der Geschichte nicht zurück, sondern nur nach vorn gedreht werden kann. Die früher tragfähige Institution der Familie ist für das Grundbedürfnis des Wohnens chronisch psychisch Kranker nicht wieder tragfähiger zu machen. Der gegenwärtige Typ des modernen Wirtschaftsbetriebes ist für das Grundbedürfnis des Arbeitens chronisch psychisch Kranker nicht wieder integrationsfähig zu machen. Das bedeutet für die heutigen Reformer, daß für das Grundbedürfnis des Wohnens chronisch psychisch Kranker die kommunale Selbstverwaltung der zeitgemäße Ersatz für die Familie zu werden hat. Kommunalisierung der Psychiatrie ist angesagt. Für das Grundbedürfnis des Arbeitens, das alle chronisch psychisch Kranken wie alle anderen Menschen haben und notwendig brauchen, wie wir heute wissen, bedeutet das, daß die psychiatrisch Tätigen selbst Unternehmer werden und Arbeitsplätze schaffen müssen. Nur weil wir in Gütersloh diese beiden Wege gegangen sind, ist es uns gelungen, den Prozeß der De-Institutionalisierung fast abgeschlossen zu haben. Die Anstalt ist aufgelöst. Fast alle chronisch psychisch Kranken sind entlassen, geblieben ist eine Klinik für akute psychische Krisen. Etwa 400 chronisch psychisch Kranke mit Aufenthaltszeiten in der Anstalt von bis zu 50 Jahren sind in normale Wohnungen entlassen worden, 100 sind in ihre Heimatgemeinden zurückgekehrt, 300 sind über die Stadt Gütersloh verstreut angesiedelt worden, 80% von ihnen ohne Hilfen oder mit den ambulanten Hilfen des »betreuten Wohnens«, 20% wegen ihres Betreuungsbedarfs zwar auch in normalen Wohnungen, aber mit Heimstatus. Tragfähige Lebens-weiten für den je einzelnen psychisch Kranken konnten daraus aber nur dadurch werden, daß wir uns auf die Unternehmerseite geschlagen und Arbeitsplätze für sie geschaffen haben: 100 Arbeitsplätze in Selbsthilfefirmen, 120 Teilzeitarbeitsplätze in Zuverdienstfirmen und 70 Arbeitsplätze in einer Werkstatt für Behinderte. Die De-Institutionalisierung und damit die Emanzipation der psychisch Kranken läßt sich nur vervollständigen, wenn nicht nur die Integration hinsichtlich des Wohnbedürfnisses in der Kommune, sondern auch die Integration hinsichtlich des Arbeitsbedürfnisses in der Wirtschaft gelingt. Insofern ist »Bürger und Irre« auch an dieser Stelle weiterzudenken: Die Psychiatrie, wenn sie denn die De-Institutionalisierung vervollständigen will, ist nicht eine Emanzipations- oder Integrationswissenschaft, sondern sie erreicht ihr Ziel erst, indem sowohl Emanzipation als auch Integration so gut gelingen, daß sie schadlos zusammenfallen. De-Institutionalisierung verlangt also die gleichsinnige soziale und ökonomische Weiterentwicklung der Gesellschaft.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bürger und Irre»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bürger und Irre» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bürger und Irre» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.