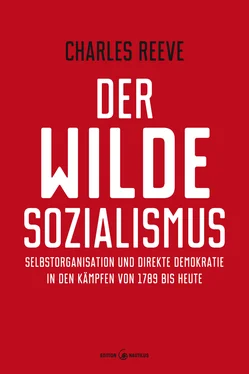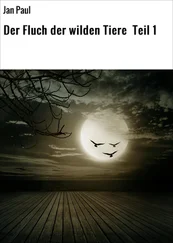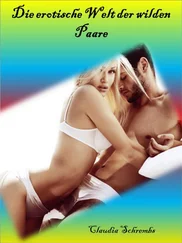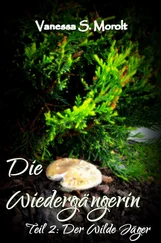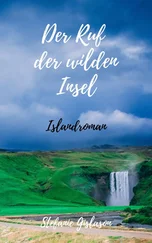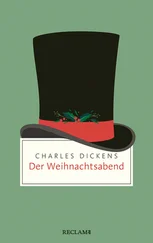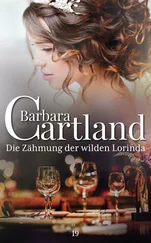Hatten die Bourses du travail zunächst eine solche emanzipatorische Bildungsfunktion, büßten sie aufgrund wachsender Abhängigkeit von der Lokalpolitik, besonders von den Gemeinde- und Stadtverwaltungen, ihren ursprünglichen Charakter zusehends ein, was es politischen Parteien erlaubte, sich an ihnen zu beteiligen und sie schließlich zu dominieren. Als tragende Elemente des revolutionären Syndikalismus entstanden, wurden sie zu Rädchen einer reformistischen, auf Integration zielenden Gewerkschaftsbewegung.
Aus dem Zusammenschluss der territorial organisierten Fédération des Bourses du travail mit der nach Branchen aufgebauten Fédération nationale des syndicats entstand 1902 der Gewerkschaftsbund CGT. 1906 votierte sie auf dem Kongress von Amiens nachdrücklich für eine revolutionär-syndikalistische Orientierung, die auf strikter Unabhängigkeit von Parteien beruhte und der direkten Aktion den Vorzug gab. Mit überwältigender Mehrheit erklärte der Kongress, man habe sich nicht »mit Parteien und Sekten aufzuhalten«, da der Syndikalismus sich selbst als ausreichend betrachte und – nach dem Generalstreik – die »Grundlage des Neuaufbaus« einer vom Kapital emanzipierten Gesellschaft sein werde. 7
Diese Perspektive bestimmte die CGT bis in die späten 1910er Jahre, als die Niederlagen bei großen Streiks, die mit direkten Aktionen, Ausschreitungen, Sabotage und Zusammenstößen mit der Polizei einhergingen, den Niedergang der revolutionär-syndikalistischen Organisation anzeigten. Nach der Inhaftierung ihrer Führung und dem Scheitern des Generalstreiks vom August 1908 drohte ihr die Auflösung durch den republikanischen Staat. Binnen weniger Monate übernahm eine reformistische Führung das Ruder, die die Grundsätze der direkten Demokratie ablehnte. Das von Aufruhr und sozialer Unruhe geprägte Klima hielt allerdings noch bis zum Vorabend des Krieges an, besonders im Großraum Paris von 1908 bis 1910. 8
Zum selben Zeitpunkt, Anfang 1908, wurden in Chicago die Industrial Workers of the World (IWW) gegründet. Ihre facettenreiche Geschichte prägte soziale und kulturelle Bewegungen in den Vereinigten Staaten nachhaltig und machte sie zum Vorbild für revolutionär-syndikalistische Organisationen. Während die IWW bestimmte Züge hatten, die sich auf die Besonderheiten der amerikanischen Gesellschaft zurückführen lassen, übernahmen sie im Grunde die Prinzipien der CGT von Amiens. Und auch wenn sie um die Form des Industriesyndikats einen ausgeprägten Organisationsfetischismus betrieben, praktizierten sie die direkte Aktion im großen Maßstab und bekämpften jede Zusammenarbeit mit den Unternehmern, insbesondere Betriebsvereinbarungen. In ihnen sahen die IWW einen Akt der Unterwerfung, der den Arbeitern auch und gerade in Momenten, in denen die Kapitalisten in der Klemme steckten, mit dem Streik ihre entscheidende Waffe nahm.
SYNDIKALISTISCH-REVOLUTIONÄRER AUFSCHWUNG UND MARXISTISCHE DISSIDENZ
Die CGT von Amiens pflegte eine schroffe Ablehnung des Einflusses von Intellektuellen, in der man den Einfluss von Bakunins Denken erkennen kann. »Intellektuelle« stand hier für die Macht des Wissens und der Führer und somit für etwas, das der größtmöglichen realen Demokratie entgegengesetzt war. Der revolutionäre Syndikalismus vertrat dagegen die kollektive direkte Aktion als ein Moment der Selbstbildung und sah im Generalstreik das einzige Mittel der Machtübernahme und gesellschaftlichen Veränderung. Ein Theoretiker der Strömung war Georges Sorel, der eine scharfe Kritik des Avantgardismus formulierte und als einer der ersten den »reformistischen Marxismus« als autoritäre Ideologie angriff. Für Sorel, einen sehr ungewöhnlichen Marxisten, war der revolutionäre Syndikalismus »der ›proletarische Sozialismus‹ – im Gegensatz zu dem kleinbürgerlichen oder politischen Sozialismus, dem Sozialismus der Intellektuellen«. 9Er sah in ihm die Verwirklichung all dessen, »was am Marxismus wahr ist«, insbesondere des Gedankens, dass der Klassenkampf »ein vom Proletariat geführter sozialer Krieg« ist und die Gewerkschaft »das Instrument« dieses Krieges. 10Der revolutionäre Syndikalismus lehnte es ab, dass Revolutionen von Vertretern politischer Kräfte gelenkt werden; er war »apolitisch« im Sinne Bakunins. Im Zentrum seiner Vorstellungen stand der Gedanke einer direkten Souveränität der Arbeiter, einer Überwindung von Vermittlungen, Systemen der Repräsentation und dauerhafter Delegierung von Macht.
Liest man die Analysen zeitgenössischer radikaler Marxisten wie Rosa Luxemburg oder Anton Pannekoek, die beide den spontanen »Massenstreik« befürworteten, dann fällt die Vehemenz auf, mit der sie sich vom revolutionär-syndikalistischen Gedanken des »Generalstreiks« abzugrenzen versuchten. Das war geradezu obligatorisch, um in den sozialistischen Organisationen Gehör zu finden und dem Vorwurf zu begegnen, man sei zu den 1896 aus der Internationale ausgeschlossenen Strömungen übergelaufen. Besonders wichtig war ihnen dabei, der revolutionär-syndikalistischen Organisation die Fähigkeit abzusprechen, als »das Instrument des sozialen Krieges« und der Revolution aufzutreten. Für marxistische Sozialdemokraten blieb diese Aufgabe bekanntlich der Partei vorbehalten – auch für diejenigen, die zur Dissidenz gegenüber dem »offiziellen« Marxismus der Sozialdemokratie tendierten, aber noch vom Gedanken der Führungspartei geprägt blieben. Das gilt selbst für jemanden wie Pannekoek, trotz des Einflusses, den Domela Nieuwenhuis auf ihn gehabt hatte, der als bedeutendster Vertreter des holländischen »libertären Sozialismus« den Generalstreik propagierte.
Interessanterweise bestand in der Gewerkschaftsfrage eine Nähe zwischen solchen Marxisten und einigen Theoretikern des Anarchokommunismus. Errico Malatesta zum Beispiel, einer der umtriebigsten und anerkanntesten Köpfe dieser Strömung, wies in einer stichhaltigen materialistischen Analyse die Vorstellung zurück, die Institution Gewerkschaft könne sich in ein revolutionäres Organ verwandeln. Auf dem anarchistischen Kongress in Amsterdam 1907 erwiderte er dem CGT-Vertreter Pierre Monatte: »Der Syndikalismus, […] selbst wenn er sich mit dem Adjektiv ›revolutionär‹ schmückt, kann nichts anderes sein als ein legaler Zusatz, eine Bewegung, die gegen den Kapitalismus auf dem wirtschaftlichen und politischen Terrain kämpft, das Kapitalismus und Staat ihr aufzwingen. Es gibt daher keinen anderen Ausweg, und es kann nichts Dauerhaftes und Allgemeines erreicht werden, wenn nicht dadurch, dass er aufhört, Syndikalismus zu sein.« Und weiter: »Entgegen allen Erklärungen seiner glühendsten Anhänger enthält der Syndikalismus, aufgrund des Charakters seiner Funktionen, sämtliche Elemente der Degeneration, die die Arbeiterbewegungen der Vergangenheit korrumpiert haben. […] Mit einem Wort: Die Arbeitergewerkschaft ist ihrem Wesen nach reformistisch und nicht revolutionär.« 11Malatesta und andere Anarchokommunisten schrieben sich deshalb die Rolle zu, in die Gewerkschaften »revolutionären Geist hineinzutragen«, womit sie ihrerseits einem dirigistischen Prinzip folgten und sich zur Trennung zwischen gewerkschaftlicher Organisation einerseits und anarchistisch-politischer andererseits bekannten.
Die theoretischen Trennungslinien zwischen radikalen Marxisten und revolutionären Syndikalisten waren auch aufgrund einer unter Hochspannung stehenden realen Bewegung nicht immer klar bestimmt. Wenn Luxemburg zum Beispiel darauf beharrte, das Proletariat könne sich seine politische Bildung allein »aus der lebendigen politischen Schule, aus dem Kampf und in dem Kampf, in dem fortschreitenden Verlauf der Revolution« 12aneignen, wich sie damit nicht grundsätzlich vom Diskurs der CGT ab, der die direkte Aktion auch als ein Moment der Selbstbildung von Arbeitern begriff. Zwar hielt Luxemburg an dem Gedanken fest, eine spezifisch politische, von den Gewerkschaften getrennte Organisation sei notwendig, doch indem sie darstellte, wie Spontaneität nicht aus dem Nichts, sondern durch frühere Praxis und Ideen, aus den Erfahrungen der gesellschaftlichen Bewegung entstehe, begann sie die Führungsfunktion der Partei differenzierter zu fassen. Die Arbeiterklasse habe nunmehr die Fähigkeit und müsse » sich selbst im Laufe des revolutionären Kampfes aufklären, selbst sammeln und selbst anführen«. 13Mit der Überzeugung, dass »das ökonomische und das politische Moment unmöglich voneinander zu trennen sind«, ja »zwischen beiden eine völlige Wechselwirkung« bestehe, unterschied sie sich kaum vom revolutionären Syndikalismus. 14Auf der anderen Seite bezog Luxemburg immer deutlicher gegen die autoritären Konzeptionen des sozialdemokratischen Marxismus Stellung. So betonte sie seine »Überschätzung und die falsche Einschätzung der Rolle der Organisation im Klassenkampf«, die zumeist mit einer »Geringschätzung der unorganisierten Proletariermasse und ihrer politischen Reife« einhergehe, und kritisierte den Anspruch der Partei, das »Kommando« zu führen. 15Mit der Feststellung schließlich, dass »unser Organisationsapparat und unsere Parteidisziplin sich einstweilen noch besser im Bremsen als im Führen großer Massenaktionen bewähren«, vollzog Luxemburg in ihrem Denken einen wichtigen Schritt, der einen Bruch mit der Sozialdemokratie nicht nur denkbar, sondern unausweichlich erscheinen ließ. 16Die späteren Debatten während der Novemberrevolution von 1918 waren in dieser Kritik der zur Bremse gewordenen Führungspartei de facto in Keimform bereits enthalten. 1918/19 gingen radikale Marxisten dann dazu über, die Notwendigkeit der doppelten Organisation, und damit die Trennung zwischen politischem und ökonomisch-gewerkschaftlichem Kampf, infrage zu stellen und einheitliche Organisationen in den Betrieben aufzubauen.
Читать дальше