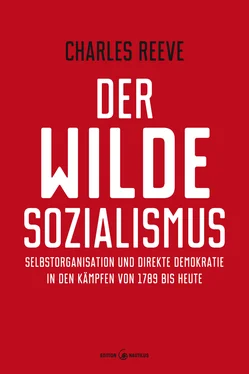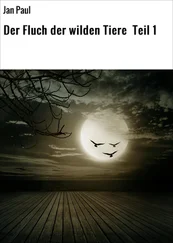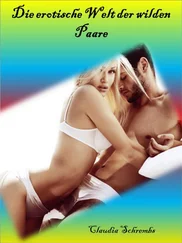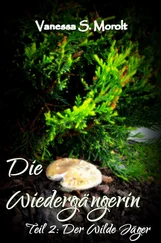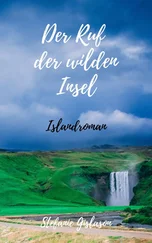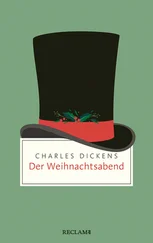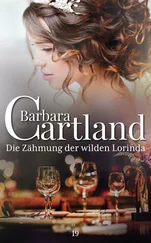Tatsächlich decken sich die Reflexionen von Le Bon und Freud teilweise mit dem Gedanken, den Bakunin ein halbes Jahrhundert zuvor entwickelt hatte, und stehen gleichzeitig in schroffem Gegensatz zu ihm. Bakunin zufolge drückte sich die von ihm so entschieden kritisierte Verwandtschaft zwischen Religion und Staatssozialismus auch darin aus, dass dieser »eine bevorrechtete Klasse, gewissermaßen eine Priesterkaste des Staates« erzeuge, »die herrschende und besitzende Klasse, welche im Staate das ist, was die Priesterkaste in der Kirche ist«. 17Während die Massen laut Le Bon eine von Grund auf destruktive Energie antrieb, erkannte Bakunin in derselben Energie einen »Instinkt der Revolte«, der eine zugleich zerstörerische wie schaffende, positive Kraft sei – Ausgangspunkt für eine Bewegung der gesellschaftlichen Emanzipation und Mittel für das gesellschaftliche Individuum, zu seiner Freiheit zu gelangen. Eine doppelbödige Haltung, um das Mindeste zu sagen, nahm dagegen die Sozialdemokratie ein: Sie machte sich die Schlussfolgerungen von Le Bon zu eigen, um ihr zentralistisch-autoritäres Parteimodell zu rechtfertigen. So erklärte etwa Karl Kautsky bereits 1911, die bewusstlosen und unkontrollierbaren Aktionen der Massen zeigten, wie notwendig die Führung durch die Partei sei, die dem kollektiven Handeln erst zu Organisation, Bewusstsein und Reife verhelfe. 18Im Zuge der Novemberrevolution 1918 meinte der SPD-Politiker Gustav Noske, der wenig später, im Januar 1919, für den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verantwortlich war, bei der Mehrheit der deutschen Arbeiter, Soldaten und Matrosen »das dem Deutschen eingeborene Bedürfnis nach Ordnung« zu erkennen – eine reaktionäre Formulierung, in der Le Bons Gedanke des willenlosen, den Führern unterworfenen Einzelnen und der passiven Masse anklang. 19
Bakunin formulierte seine Gedanken in einer wenig ausgefeilten Weise, seine Argumentation blieb mitunter vage und inkonsistent. Abstrakte Systeme lehnte er ab, da sie in seinen Augen nur Denken und Handeln lähmten. Bakunins Theorie war das Spiegelbild eines unbändigen Lebens und taugte nicht zur Weltanschauung. In der Organisationsfrage hatte sie auf die nicht-individualistischen Strömungen des Anarchismus wenig Einfluss; diese schwankten stattdessen zwischen dem »Plattformismus« eines Peter Arschinoff, der eine Art anarchistische Partei vorsieht, und dem klassischen Modell der gewerkschaftlich-politischen Doppelorganisation, wie es neben vielen anderen die spanische CNT-FAI (Confederación Nacional del Trabajo/Federación Anarquista Ibérica) am erfolgreichsten verkörperte. Bakunin selbst zeigte sich in seiner Organisationspraxis besonders widersprüchlich – auch in der Internationale und seinem Kampf gegen Marx. Er beharrte auf der Vorstellung, dass die revolutionäre Aktion von kleinen zentralisierten und klandestinen Gruppen ausgehen müsse, und zog Arbeiter damit in revolutionäre Verschwörungen, die zum Scheitern verurteilt waren. Während er in der Theorie das widersprüchliche Verhältnis zwischen dem Autoritätsprinzip und einer Bewegung der gesellschaftlichen Selbstbefreiung aufzeigen konnte, blieb er selbst Gefangener des damals noch vorherrschenden jakobinisch-babouvistischen Aufstandsmodells. Spontanes Handeln erschöpfte sich für Bakunin in einem »Instinkt der Revolte«, der auf das Wirken von Berufsrevolutionären mit der besonderen Fähigkeit angewiesen blieb, den subversiven Gedanken ins allgemeine Bewusstsein zu heben. Ohne ein solches Eingreifen konnte es auch keine Selbstorganisation geben.
Die Kritik des Autoritätsprinzips schlug ohne Frage eine Bresche in die jakobinisch-hierarchische Gedankenwelt der sozialistischen Bewegung. In dieser setzte sich die Einschränkung der vollen Souveränität – das »Korrektiv«, das die permanente Repräsentation von Macht darstellte – als Unterordnung unter die Führung und als Blockade individueller wie kollektiver Fähigkeiten der Emanzipation fort. Die Unmöglichkeit einer ungeschmälerten Ausübung der Volkssouveränität, die Abwesenheit direkter Demokratie, ließ die Mängel des parlamentarischen Systems sowie die soziale Ungleichheit, auf der es beruhte, immer deutlicher hervortreten. Die repräsentative Demokratie erschien als Negation jeder Demokratie und nährte so das Verlangen nach gesellschaftlicher Emanzipation. Dreißig Jahre nach den ersten Andeutungen durch die Pariser Kommune musste die soziale Bewegung das System der Repräsentation aufbrechen, um solchen neuen Bedürfnissen konkret Rechnung zu tragen. Nur im Bruch mit dem Sozialismus der Führer und Apparate, auf wilde, ungezähmte Weise, konnte sie Gestalt annehmen.
KAPITEL 4
GENERALSTREIK ODER MASSENSTREIK?
DER REVOLUTIONÄRE SYNDIKALISMUS UND DAS BEDÜRFNIS NACH SELBSTREGIERUNG
SELBSTBILDUNG
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Sozialdemokratie in Deutschland, Belgien, Holland und Russland die unangefochtene Hauptkraft in der organisierten Arbeiterbewegung. Als solche rückte sie von Marx’ Überzeugung, das kommunistische Bewusstsein werde aus dem Proletariat selbst hervorgehen, immer stärker zugunsten einer Konzeption ab, die die zentralistisch-hierarchische Partei als Trägerin des Klassenbewusstseins begriff. Bakunins Warnungen vor den widersprüchlichen Folgen des etatistischen Modells wurden ignoriert oder schlicht vergessen. In anderen Ländern, vor allem in Frankreich, Italien und Spanien, behielten antiautoritär-anarchistische Kräfte dagegen ein starkes Gewicht in der Arbeiterbewegung und widersetzten sich dieser Marschrichtung. Natürlich lehnte die Sozialdemokratie der Zweiten Internationale den Föderalismus zugunsten eines Zentralismus ab, der als Gewähr für Disziplin, Realismus, Effektivität und somit für die Stärke der Arbeiterbewegung galt – ein Argument, das der linke Flügel der russischen Sozialdemokratie, die Bolschewiki, sowie später die bolschewisierte Dritte Internationale übernahmen und das sämtliche avantgardistische Strömungen, Gruppen und Sekten bis heute anführen. Die Mittel, auf denen diese Effektivität beruhte, sahen die sozialdemokratischen Marxisten in keinerlei Widerspruch zu den Zielen, zumal das Erstarken ihrer Parteien in den Ländern, in denen sie die Bewegung dominierten, stetig und unaufhaltsam voranzuschreiten schien. Dieses Wachstum galt als Beweis dafür, dass die Führung die richtige Linie verfolgte und mit dem Strom der Geschichte schwamm. Wie Bakunin bemerkt hatte, maßten sich die »Chefingenieure« des Sozialismus an, Aufstände wie Maschinen steuern zu können; dass ihr autoritäres Agieren jede spontane Initiative von unten erstickte und früher oder später nur zur Lähmung von Bewegungen führen konnte, erkannten sie nicht. Damit entfernten sie sich von der Auffassung Joseph Dietzgens, eines Freundes von Marx, der eindringlich gemahnt hatte, ein Arbeiter, der an der Selbstbefreiung seiner Klasse teilnehmen wolle, müsse es zuallererst ablehnen, sich von anderen bilden zu lassen, und sich stattdessen selbst bilden. Genauso fremd war ihnen Bakunins Gedanke, dass die Revolution, »wenn sie in den Händen einiger regierender Personen konzentriert ist, […] unvermeidlich und unverzüglich zur Reaktion wird«. 1Im Namen ihres dirigistischen Programms betrieben die sozialdemokratischen Führer die »Schulung« der Massen mit den ihnen eigenen Mitteln – Partei und Gewerkschaft. Der geistigen und praktischen Selbstbestimmung der Individuen, ihrer Spontaneität, hielten sie die Autorität der »Wissenschaft« und die bürokratische Macht ihrer Organisationen entgegen. Dass deren Wachstum in die blinde Unterordnung der Arbeiterbewegung unter die Führer, ihre Lähmung im Angesicht der patriotischen Kehrtwende der Sozialdemokratie sowie schließlich in ihre Zerstörung durch das Kriegsgemetzel ab 1914 führen würde, schien undenkbar.
Читать дальше