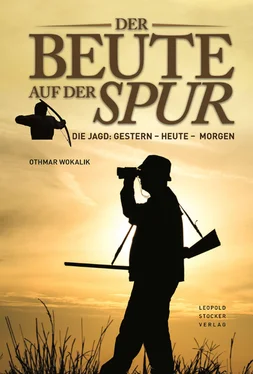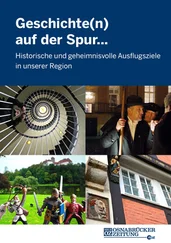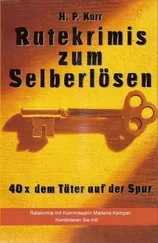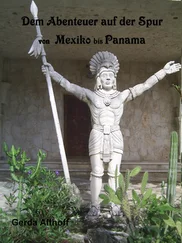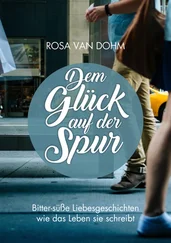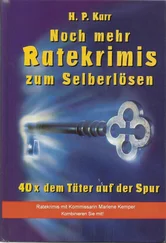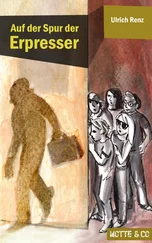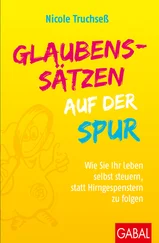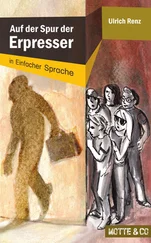Damit begann die allmähliche Entvölkerung dieses Siedlungsraumes auf der Suche nach Wasser und ertragreichen Böden. In dem noch dicht bewachsenen „Tal des großen Stromes“ (Nil) mit seinen unzähligen Verästelungen fanden die Ägypter der Frühzeit den Ersatz für ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet. Das Tal des Stromes versprach reichen Ertrag, weil die jährlichen Überschwemmungen die vermissten Niederschläge ersetzten und die vom Nil mitgeführten Senkstoffe das Land stets neu düngten.
Auf einer in der Westsahara gefundenen Felszeichnung lassen sich mehrere Epochen unterscheiden; die ältesten, die Mammuts darstellen, stammen noch aus der Steinzeit. Das Mammut und die anderen dargestellten Wildtiere untermauern die These von der grünen Sahara. Ob die mit Speer und Schild abgebildete Figur einen Jäger zeigt, ist wohl nicht einwandfrei zu klären, kann aber aufgrund der dargestellten Wildtiere angenommen werden.
Infolge der erhaltenen schriftlichen und bildlichen Dokumente aus der Geschichte Ägyptens lässt sich die Tradition der Jagd bis in die Zeit des Alten Reiches (2600–2190 v. Chr.) zurückverfolgen. Neben dem Vorrecht der Pharaonen, Nilpferde und Wildstiere zu jagen, zeigen uns bildliche Darstellungen in den Kult- und Opferkammern der Aristokraten und hohen Beamten dieser Zeit, dass sie vor allem der Jagd auf Flugwild und dem Fischfang, besonders in dem an Üppigkeit in Flora und Fauna kaum zu überbietenden Nildelta, ergeben waren.
Die Treibjagd auf Großwild ist ebenso wie die Verwendung von Fallen ebenfalls bereits für das Alte Reich nachgewiesen. Auf den schon erwähnten Felszeichnungen aus der Sahara und denen, die am Nil gefunden wurden, sind Szenen der Fallenjagd dargestellt. Besonders häufig wurden Trittfallen zum Einsatz gebracht. Eine aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. stammende, in Oberägypten (Nechen) gefundene Wandmalerei zeigt eine kranzförmig angelegte Falle, in der sich Antilopen gefangen haben.
Bei der Jagd auf Flugwildin der weiten Sumpflandschaft des Nildeltas bediente man sich verschiedener Lockvögel. Hier lagen, wie erwähnt, die bevorzugten Jagdreviere der Ägypter. Fische und Nilpferde wurden aus dem Boot harpuniert. Die Boote waren aus Papyruspflanzen gefertigt, einem damals wichtigen Faserrohrstoff, der auch als unentbehrliches Schreibmaterial Verwendung fand. Die Jagd auf Vogel und Fisch war im Alten, teilweise auch im Mittleren Reich, ein Privileg des Herrschers, welcher der Marschengöttin Sechmet als der Herrin der Jagd und somit der Herrin des Vogel- und Fischfanges diente.
Die aufwendigen Jagden der Höflinge und hohen Beamten fanden sehr oft in Begleitung ihrer Frauen und Kinder, stets aber unter Mithilfe ihrer Bediensteten statt. Die Vögel wurden in ihren Nestern und auch während der Brutzeit erlegt oder, nachdem sie von abgerichteten kleinen Raubtieren, wie Ginsterkatzen oder Ichneumonen (Schleichkatzen), aufgescheucht worden waren, mit dem Wurfholz erbeutet, was eine beachtliche Fertigkeit in der Handhabe dieses Gerätes erforderte.
Beim Fang mit dem Netz kamen sowohl Wurfnetze als auch Stellnetze zum Einsatz. Die ebenso naturgetreuen wie eindrucksvollen Darstellungen von aus dem Papyrusdickicht abstreichenden Wildgänsen und Enten gehören zu den schönsten Tierdarstellungen in der altägyptischen Kunst. Es waren überwiegend Nilgänse, Grau- und Blässgänse, verschiedene Reiherarten, Löffler, Blässhühner, Spießenten und Rotkopfenten, die im üppigen Nildelta bejagt wurden. Die Wildente wurde anfänglich kaum bejagt; erst relativ spät, d. h. seit der 12. Dynastie (200 v. Chr.), wird häufig von der Jagd auf Enten berichtet.
Auch die Domestikation von Wildtieren, wie sie ab der 5. Dynastie überliefert ist, ebenso wie die Anlage von Tiergärten etwa ab der Zeit um 1500 v. Chr., waren in Ägypten üblich. Von einem Geflügelhof vor ca. 4.500 Jahren berichtet uns ein Kalksteinrelief (5. Dynastie). Das Relief zeigt, dass dort Kraniche und Wildgänse gehalten und gefüttert wurden. Aus den in der Nähe des Tempels Deir el-Bahari ausgegrabenen, umfassenden bildlichen Darstellungen und Berichten wissen wir, dass die Königin Hadschepsut um 1500 v. Chr. einen Tiergarten anlegen ließ, in welchem nicht nur heimische Tierarten, sondern auch Großwild aus Nordafrika und indische Elefanten gehalten wurden. Damit war die verlässliche Versorgung des Königshauses nicht nur mit Wildgeflügel, sondern auch mit Wildbret gewährleistet.
Erwiesen ist damit aber auch eine erstaunliche infrastrukturelle Transportkapazität, handelt es sich doch bei diesen Tieren um Großwild, welches aus weitentlegenen Weltgegenden (Indien) importiert wurde.
Die Jagd auf Großwildwar bis zu Beginn der 18. Dynastie (1555–1330 v. Chr.) infolge der gänzlichen Ausrottung der Wildbestände im nordafrikanischen Steppengebiet – die beliebten Nilpferdjagden ausgenommen – so gut wie unbekannt. Erst auf ihren ausgedehnten vorderasiatischen Kriegs- und Jagdzügen wurden die Ägypter mit den Jagdmethoden der assyrischen Könige auf Großwild vertraut.
Ein für die Jagdgeschichte einmaliger archäologischer Fund waren in diesem Zusammenhang 350 Tontafeln in babylonischer Keilschrift in der Ruinenlandschaft von Tell el-Amarna aus der Zeit um ca. 1350 v. Chr. Auf diesen Tontafeln in der vormaligen Residenz des Pharao Amenophis IV. finden sich umfangreiche Berichte über die Jagderfolge des Pharao. Aus einem dieser Berichte geht hervor, dass Thutmosis III. in der Steppe von Niya bei einer seiner Jagden die unvorstellbare Menge von 120 Elefanten erlegt habe, wenn der Bericht zutreffend ist. Ein solcher Jagderfolg war wohl nur aufgrund der Teilnahme von Adeligen und/oder Kriegern an dieser Jagd möglich geworden.
Auch die Löwenjagd findet in dieser Zeit häufig Erwähnung, so in Form einer Abbildung auf einer Truhe aus der Grabausstattung des Königs Tutanchamun (1347–1338 v. Chr.). Von den hier dargestellten acht Löwen hat der junge Pharao bereits sieben tödlich verwundet, während er auf den achten, einen flüchtigen Löwen, mit dem Bogen zielt.
Auf einem Skarabäus aus dieser Periode wird berichtet, dass König Amenophis III. innerhalb eines Dezenniums 102 Löwen gestreckt habe. Aus einem weiteren Bericht erfahren wir, dass es dem König gelungen sei, in nur vier Tagen aus einer Herde von 170 Wildstieren insgesamt 96 zu erlegen. Nach dem Vorbild der Perser gingen die Ägypter infolge der gewaltigen Ausdehnung ihres Herrschaftsbereiches – wie die Assyrer und Griechen auch – dazu über, Elefanten in großer Zahl einzufangen, zu zähmen und die Tiere sodann als Jagd- und Kriegselefanten, aber auch als Last- und Zugtiere einzusetzen.
Vom persischen Großkönig wird unter anderem berichtet, dass er über eine Herde von 9.000 Elefanten verfügte; die Elefanten wurden von den indischen Hilfstruppen gestellt und waren zur Zeit Alexander des Großen eine „Revolution“ in der Geschichte des Jagd- und Kriegswesens.
Unter dem ägyptischen König Ptolemaios II. (283–247 v. Chr.) wurde der Lebendfang von Elefanten im Großen betrieben. Die gefangenen Tiere wurden vorwiegend aus Äthiopien auf speziell hierfür konstruierten Elefantenbooten über das Rote Meer nach Ägypten gebracht.
Davon abgesehen war Elfenbein nach und nach zur Handelsware geworden, was schließlich dazu führte, dass der Elefant in Äthiopien, Libyen, Mauretanien, besonders aber in Nordafrika und Vorderasien, ausgerottet wurde. Das gleiche Schicksal erlitten – wenn auch nicht aus kommerziellen Gründen – der europäische Löwe in Griechenland und der Berberlöwe in Nordafrika. Das Ausmaß der erhaltenen schriftlichen Aufzeichnungen und bildlichen Darstellungen der Ägypter zeigt, dass die Jagd in diesem alten Kulturraum jedenfalls eine überragende, wenn auch andere Bedeutung als bei den Sumerern, Assyrern und Babyloniern hatte.
Читать дальше