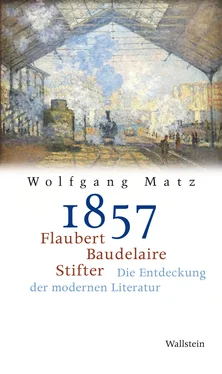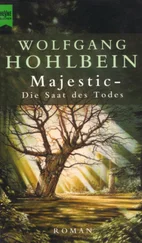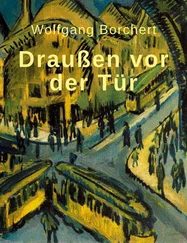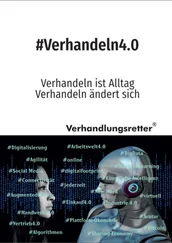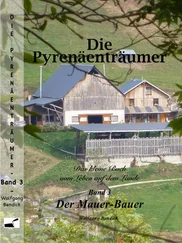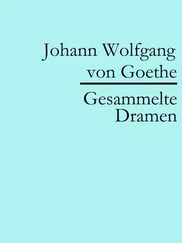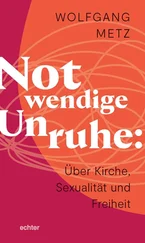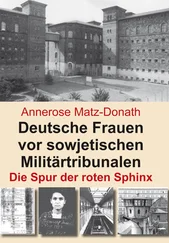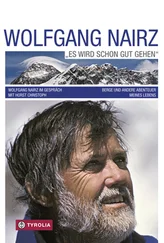Diese Kriterien müssen für Familie, Freunde und Bekannte nach wie vor schwer begreiflich gewesen sein, denn noch immer war Flauberts Schaffen bestimmt durch extrem gegensätzliche Tendenzen. In einem berühmten Brief an Louise Colet wird er am 16. Januar 1852 im Rückblick analysieren, wie er seine Situation nach Abschluss der Éducation sentimentale empfand: »Es gibt, literarisch gesprochen, zwei deutlich unterschiedene Burschen in mir: Der eine ist begeistert von Brüllerei [ gueulades ], von Lyrismus, von hohen Adlerflügen, von allen Wohlklängen des Satzes und den Gipfeln des Gedankens; der andere wühlt und gräbt, so tief er kann, in das Wahre und liebt es, das kleine Faktum ebenso kräftig herauszuarbeiten wie das große, er möchte die Dinge, die er reproduziert, fast materiell spüren lassen; dieser liebt das Lachen und gefällt sich im Animalischen des Menschen. Die Éducation sentimentale war, ohne mein Wissen, ein Versuch, die beiden Tendenzen meines Geistes zu verschmelzen (es wäre leichter gewesen, in einem Buch das Menschliche zu gestalten und in einem anderen den Lyrismus). Ich bin gescheitert. […] Zusammengefasst: Man müsste für die Éducation das ganze neu schreiben oder wenigstens neu abstützen, man müsste zwei oder drei Kapitel neu machen und, was mir am allerschwierigsten scheint, ein fehlendes Kapitel schreiben und in ihm zeigen, wie der Stamm sich zwangsläufig hat verzweigen müssen, das heißt, warum eine bestimmte Handlung bei einer Person ein bestimmtes Ergebnis gehabt hat und nicht eine andere. Die Ursachen werden gezeigt, die Ergebnisse auch; aber die Verkettung von Ursache und Wirkung keineswegs. Da liegt der Fehler des Buches, und deshalb straft es seinen Titel Lügen.« Flaubert ist hier in seiner Selbstkritik nicht wirklich konsequent. Zum einen erkennt er sehr genau den Mangel an präziser Analyse der Figuren und vor allem ihrer äußeren Bedingungen, aus denen er, beinahe deterministisch, ihr Schicksal ableiten will. Zum anderen sieht er aber in der Éducation etwas, was eher Novembre gewesen ist, nämlich die Verbindung von Analyse und Lyrismus, und genaugenommen hatte sich Flaubert noch nie so weit vom puren Lyrismus entfernt wie mit der Éducation . Auch der Begriff der »Verschmelzung« – »un effort de fusion« – trifft nur begrenzt, stehen doch die beiden Tendenzen in den frühen Schriften noch einigermaßen unverbunden einander gegenüber.
Als Flaubert seinen Brief an Louise Colet schreibt, liegt die Erfahrung der größten »gueulade« bereits hinter ihm, und auch sie ist von Scheitern gekrönt: »Ich habe Dir gesagt, dass die Éducation ein Versuch gewesen ist, Saint Antoine ist ein weiterer. Da ich ein Thema gewählt hatte, das mir für Lyrismus, Bewegungen, Verwirrungen völlige Freiheit ließ, befand ich mich mit meinem Wesen ganz in Übereinstimmung und brauchte nur vorwärtszugehen. Nie wieder werde ich solche Berauschungen am Stil erreichen, wie ich sie mir hier achtzehn Monate lang gönnte! Mit welcher Begeisterung schliff ich die Perlen meines Colliers! Ich habe nur eins vergessen, den Faden. Zweiter Versuch und schlimmer noch als der erste. Jetzt bin ich an meinem dritten. Es ist Zeit, etwas zu schaffen oder aus dem Fenster zu springen.« Der Saint Antoine aber ist genauso wenig, wenn auch in anderem Sinne, wie die Éducation eine »Verschmelzung«, ist vielmehr der radikalste Ansatz, die »gueulade« zum Stilprinzip eines gesamten Werkes zu machen, den Flaubert je unternehmen sollte, ist nach der Éducation , dem letzten autobiographischen und ersten gegenwartsanalytischen Roman, der Versuch, das große Werk in genau der entgegengesetzten Richtung zu suchen.
Auf dem Weg dahin bewegte sich Flaubert nahezu systematisch. Die Éducation war im Januar 1847 abgeschlossen, die Voyage en Italie , das nächste umfangreiche Manuskript, ist jedoch vor allem Tagebuch und kein durchformuliertes Werk. Anders das 1847 niedergeschriebene Par les champs et par les grèves : Flaubert war im Mai 1847 zu einer drei Monate dauernden, hauptsächlich zu Fuß unternommenen Reise durch das Anjou, die Bretagne und die Normandie aufgebrochen, in Begleitung des Pariser Literaten und Freundes Maxime Du Camp. Das Reisejournal sollte nach der Rückkehr zu einem kleinen Buch ausgearbeitet werden, wobei verabredungsgemäß Flaubert die ungeradzahligen, Du Camp die geraden Kapitel zu schreiben hatte. Flaubert aber nutzte die Aufgabe zu etwas ganz anderem, er machte die vorgegebenen, eher anspruchslosen Themen, die Beschreibung von Orten und Landschaften, Städten und Gebäuden, Situationen und Begegnungen zu der konsequentesten Stilübung, der er sich bislang unterzogen hatte, und so ist das kleine Reisebuch das erste, das tatsächlich im Stile des reifen Flaubert durchgehört ist auf Rhythmus und Klang, auf Schwung und Satzmelodie, kurz: das dem sprichwörtlich gewordenen Perfektionsideal entsprach. Erst nach dieser Übung ging er an den Saint Antoine , dessen Idee ihn seit dem ersten Blick in Genua begleitete.
Wie kompliziert die Auseinandersetzung jener beiden »deutlich unterschiedenen Burschen in mir« blieb, verrät ein vorausschauender Blick auf den Kalender der folgenden Jahre. Anfang 1848 ist Flaubert in Paris und erlebt dort aus nächster Nähe die Revolution und ihre Barrikaden – ein Ereignis, das viele Jahre später zum entscheidenden Katalysator für die große und in jeder Hinsicht vollendete Éducation sentimentale werden wird. Im Jahr der Revolution selbst aber tut Flaubert etwas ganz anderes: Er kehrt zurück nach Croisset und beginnt dort die Arbeit am Saint Antoine , dem Hauptwerk des ersten, von Brüllerei begeisterten Burschen. Kaum sechs Wochen nach dem Scheitern des Saint Antoine , das am 12. September 1849 zu den Akten genommen wird, verlässt Flaubert Croisset, um erst im Mai 1851 wiederzukehren. Dazwischen liegt jener lang erträumte Aufenthalt im Orient, in Ägypten, Nubien, Palästina und dem Libanon, der dann seinerseits zur Quelle des anderen großen phantasmagorischen Romans, der »purpurnen« Salammbô , werden wird. Doch auch dieser Ertrag seiner Reise wird nicht sofort, sondern erst ein Jahrzehnt später eingefahren, denn zuvor schlägt endlich die große Stunde des zweiten Burschen. Er »wühlt und gräbt, so tief er kann, in das Wahre«, und ans Licht bringt er Madame Bovary , den Jahrhundertroman mit dem Untertitel Mœurs de province , Sitten in der Provinz.
Doch bevor es so weit war, musste Flaubert in seiner Éducation noch eine Lektion lernen. Die Pariser Revolution von 1848 ist die letzte, die den Ehrennamen Revolution trägt, und sie ist nach 1789 und 1830 die dritte in einem Prozess, in dem gesellschaftlicher Optimismus und restaurative Zurücknahme in enger werdendem Rhythmus aufeinanderfolgen. Das ungelöste Problem, das diesen antreibt, ist der Übergang vom späten Absolutismus zu einer Staatsform, in der die neuen gesellschaftlichen Kräfte des neunzehnten Jahrhunderts integriert werden können. Diese stark vereinfachte Formel umfasst jedoch eine Vielzahl von Faktoren, zu denen nicht nur die das ganze Jahrhundert über offene Frage des Regierungssystems zählt, sondern besonders auch die soziale Frage der städtischen Industrialisierung und die regionale der starken Trennung von Kapitale und Provinz im extrem zentralisierten Frankreich. Da mit der Revolution von 1789 und dem aus ihr hervorgegangenen Empire Napoleons am Anfang dieser Entwicklung eine Konstellation von unerhörter Ausstrahlung im historischen, symbolischen und ästhetischen Sinne steht, ist das 1815 mit der Restauration beginnende Jahrhundert eines der kontinuierlichen, nur von phasenweise auftretenden Konvulsionen unterbrochenen Desillusionierung und, auf der Ebene politischer Ästhetik, der Trivialisierung. Mit jeder dieser Zäsuren: dem Sturz Napoleons und der Restauration 1815, der Julirevolution 1830 und ihrem Ersticken in der Monarchie Louis-Philippes, der 48er- Revolution und ihrem Ende im Second Empire Napoleons III., mit jeder dieser Zäsuren wird gleichsam ein Stück aufgezehrt von der optimistischen revolutionären Grundsubstanz. Dieser Erosionsprozess bedeutet zugleich die fundamentale Verbürgerlichung der Gesellschaft. Solange das Bürgertum in Opposition zur Herrschaft von Adel und Klerus stand, konnte es sich noch als fortschrittliche Kraft, gar als legitimer Nachfolger von Aufklärung und Revolution sehen; Rot und Schwarz , Stendhals Roman aus dem Jahre 1830 mit dem Untertitel Chronik aus dem neunzehnten Jahrhundert , ist dafür das kanonische Dokument. 1848 macht diese Überzeugung zunichte.
Читать дальше