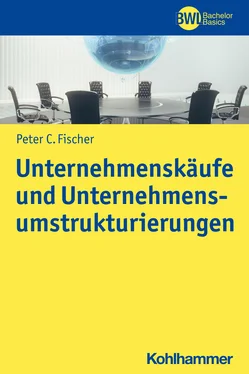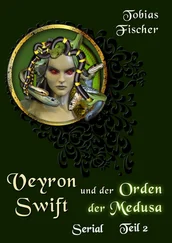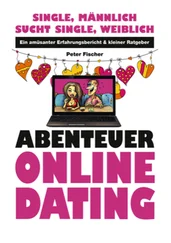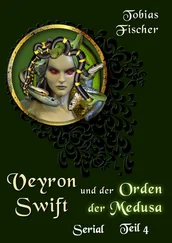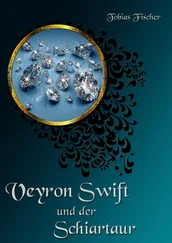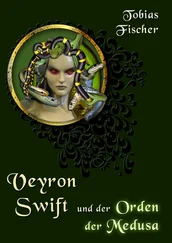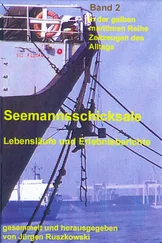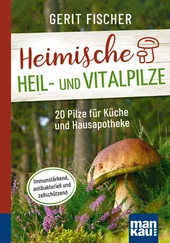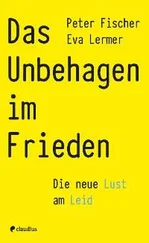In der Wissenschaft dürfte das führende Verhandlungsmodell die sog. Harvard-Methode von Roger Fisher, William Ury und Bruce Patton sein (vgl. Fisher/Ury/Patton, Das Harvard-Konzept). Das Harvard-Konzept beruht im Kern auf vier Empfehlungen (► Abb. 1).
Leider beherzigen bekanntlich nicht alle Verhandler diese Empfehlungen (man denke nur einmal an US-Präsidenten Donald Trump), was durchaus jedenfalls kurzfristig zu Erfolgen führen mag, es ist aber in jedem Fall hilfreich, wenn jeder Verhandler die Empfehlungen kennt und vor allem erkennt, wenn die Gegenseite die Harvard-Methode (mehr oder weniger bewußt oder unbewußt) anwendet. Gerade bei Beteiligungserwerbungen bei der die Beteiligten auch nach dem Closing noch auf Gesellschafterebene langfristig zusammenarbeiten müssen, dürfte eine Verhandlungsführung unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Harvard-Methode regelmässig

Abb. 1: Harvard-Methode
zweckmäßig sein, solange die Gegenseite sich darauf einläßt (vgl. zu Verhandlungen von VC-Beteiligungsverträgen Lambsdorff in Drygala/Wächter, VC, S. 227 ff.). Ganz anders ist die Situation, wenn es nach dem Erwerb sämtlicher Anteile einer Gesellschaft zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt: In einer Prozesssituation, also wenn ohnehin bereits die emotionale Ebene nachhaltig erschüttert sein dürfte, kann dagegen eine aggressive, unkooperative Strategie vielleicht sogar unter bewusster Verletzung der Empfehlungen der Harvard-Methode durchaus erfolgversprechend sein (kritisch gegenüber der Harvard Strategie gerade bei M&A-Projekten Rock, Erfolgreiche Verhandlungsführung mit dem Driver-Seat-Konzept, insb. S. 429 ff.).
Praxishinweis: Manchmal bringen ausgerechnet Rechtsanwälte ohne Not eine unnötige Schärfe in Verhandlungen, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass Anwälte nicht selten vor allem den eigenen Mandanten beeindrucken wollen. Gerne liefern sich Anwälte auch akademische Scharmützel untereinander, obwohl die diskutierten Themen ohne besondere wirtschaftliche Relevanz für die Transaktion sind. Allerdings sollte eine Partei auch in derartigen Situationen den eigenen Anwalt niemals vor der Gegenseite zur Ordnung rufen, vielmehr ist es wichtig, dass jedenfalls nach außen auf die Geschlossenheit der eigenen Reihen geachtet wird.
Zu Beginn der Transaktionsverhandlungen sollte jede Seite eine klare Definition von Zielen und Verhandlungspositionen einschließlich einem etwaigen » Plan B« vornehmen (kein Abschluss um jeden Preis). Allerdings kann die Plan B-Überlegung auch dazu führen, dass der eigentliche Plan A nicht hartnäckig genug verfolgt wird. In jedem Fall sollte aber immer auch die Offenheit für alternative Transaktionsstrukturen beibehalten werden.
Eine unschöne Erscheinung bei Verhandlungen ist das Zurückhalten wichtiger Forderungen oder überraschende Offenlegungen von Problemen zu einem sehr späten Zeitpunkt in den Verhandlungen. Sollte eine derartige Überrumpelung am Ende der Verhandlungen nicht funktionieren, kann ein solches Verhalten das Vertrauen der Gegenseite nachhaltig erschüttern und sollte daher im Zweifel vermieden werden (vgl. Lambsdorff in Drygala/Wächter, VC, S. 227).
Ganz im Gegenteil mag es Sinn machen, wenn gleich zu Beginn einer Transaktion » Pflöcke eingeschlagen werden« und klar kommuniziert wird, dass bestimmte Punkte wirtschaftlich nicht verhandelbar sind. Allerdings ist dann darauf zu achten, dass hier das Risiko einer Unwirksamkeit gerade dieser späteren Regelung im Unternehmenskaufvertrag unter dem Gesichtspunkt der Inhaltkontrolle gem. AGB-Recht (§§ 305 ff. BGB) besteht (► Teil II 5.1).
Beispiel: So mag es etwa für den Verkäufer im Rahmen eines Auktionsverfahrens Sinn machen, bereits vor der Öffnung des Data Room klar zu stellen, dass es für Altlastenrisiken keine Garantien oder gar Freistellungen geben wird. Ein Bieter, der sich trotzdem weiter an dem Bietungsverfahren beteiligt, wird bei etwaigen späteren Verhandlungen über den Kaufvertrag kaum mit der Forderung nach Altlastengarantien oder (den nicht ganz unüblichen) Altlastenfreistellungen durchsetzen. Die genaue Übermittlung und Formulierung dieser Vorgabe sollte aber mit nicht ohne sorgfältige juristische Prüfung erfolgen, da hier das – vorstehend bereits erwähnte – Risiko einer Unwirksamkeit gem. § 307 BGB droht.
15 Erstellung des Entwurfs des Unternehmenskaufvertrags
Im Zentrum der Verhandlungen stehen dann vor allem der Umfang und die Formulierung von Garantien des Verkäufers. Hier wird oft um jedes Wort erbittert gekämpft. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was für einen ersten Entwurf des Unternehmenskaufvertrags (Share Purchase Agreement oder Sale and Purchase Agreement, SPA) die diesen Entwurf erstellende Partei (im Falle eines Auktionsverfahrens der Verkäufer, ansonsten meist der Käufer) der Gegenseite vorlegt: Oft werden hier extrem einseitige Vorschläge gemacht, was später zu sehr langwierigen Verhandlungen führt, andererseits hat dieses Verfahren den Vorteil, dass der finale Vertrag möglicherweise immer noch viele vorteilhafte Regeln für die Partei enthält, die den unausgewogenen Ausgangsentwurf erstellt hat. Vor diesem Hintergrund sollte die Partei, die den ersten Entwurf nicht erstellt hat, immer darauf bestehen, den nächsten Entwurf als Markup-Version zu erstellen (und dies keinesfalls aus Bequemlichkeit oder Kostengründen den Anwälten der Gegenseite überlassen).
Praxishinweis: Da im Laufe einer Transaktion häufig zahlreiche Entwürfe hin und her geschickt werden, ist auf organisatorischer Ebene darauf zu achten, den Überblick zu behalten. Für den Fall späterer Streitigkeiten über die Auslegung einzelner Klauseln wäre es hilfreich, wenn die Geschichte einzelner Klauseln nachvollziehbar wäre, da dies (ähnlich der historischen Auslegung bei Rechtsnormen) durchaus ein Auslegungskriterium ist (Palandt/Ellenberger § 133 Rd. 16, Einf. v. § 145 Rd. 18; Mehrbrey in Mehrbrey, M&A Litigation § 2 Rd. 307 f. m. w. N.).
Bei Auktionsverfahren wird von den Bietern eine Markup-Version des SPA verlangt, in welchem die gewünschten Änderungen hervorgehoben werden. In Kombination mit dem Kaufpreisangebot hat der Veräußerer dann eine optimale Basis für die Entscheidung mit welchem Bieter er weiterverhandeln möchte.
Praxishinweis: In den Entwürfen werden teilweise Vorschläge z. B. zu Haftungsgrenzen in [eckige Klammern] gesetzt. Hierdurch wird deutlich gemacht, dass dies nur Vorschläge sind, die explizit zur Disposition gestellt werden. Dies ist auch im Hinblick auf eine mögliche AGB-Inhaltskontrolle gem. §§ 305 ff. BGB ein zweckmässiges Vorgehen (► Teil II 5.1).
16 Rechtskulturelle Unterschiede bei der Vertragsgestaltung
In technischer Hinsicht ist die Kautelarjurisprudenz, also die Vertragsgestaltung zur Vermeidung späterer Rechtsprobleme, im angelsächsischen Rechtsraum traditionell höher entwickelt als in Deutschland. Dies mag damit zusammenhängen, dass in den angelsächsischen Common Law Jurisdictions (vor allem England und den USA) das dortige Fallrechtssystem (Case Law) erhöhte Anforderungen an die Vertragserstellung stellt, da ein Rückgriff auf einen Kodex mit umfassenden abstrakten Regelungen für alle Fallkonstellationen wie in den Civil Law-Ländern Kontinentaleuropas nicht möglich ist. In Deutschland sind die maßgebenden Kodizes bekanntlich das Bürgerliche Gesetzbuch/BGB (German Civil Code) und das Handelsgesetzbuch/HGB (German Commercial Code). Die strukturellen Unterschiede der Rechtssysteme (Civil Law vs. Common Law) haben weitreichende praktische Konsequenzen:
• Angelsächsische Verträge sind umfassender, da sie alle Details abschließend regeln (Picot in Picot, Unternehmenskauf, § 1 Rd. 42), und funktionieren mit ihren zahllosen Definitionen wie ein Uhrwerk. Dies ist oft sehr eindrucksvoll, birgt aber auch Gefahren, wenn hier im Detail Fehler auftreten sollten. Auch aus diesem Grunde gibt es z. B. in Londoner Kanzleien sog. proof reader, dies sind Mitarbeiter in Kanzleien, die ohne Involvierung in konkrete Mandate, Entwürfe akribisch auf Stimmigkeit überprüfen. Das Problem derartig umfassender Verträge besteht auch darin, dass die Parteien selbst die Verträge gar nicht mehr selbst nachvollziehen können und damit vollkommen abhängig von ihren meist externen Rechtsberatern sind.
Читать дальше