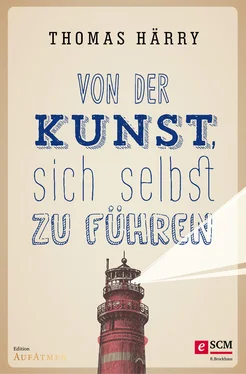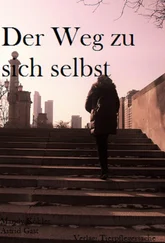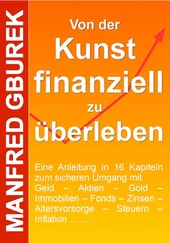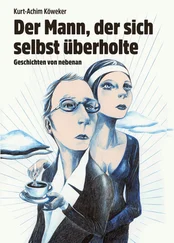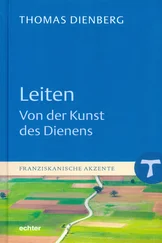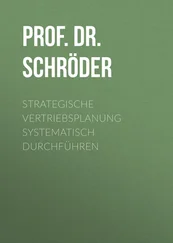1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Es begann damit, dass die ersten Menschen ihre Würde nicht dankbar annahmen und einsetzten. In 1. Mose 3 können Sie nachlesen, wie der Mensch nach den Sternen griff und dabei in den Abgrund stürzte. Er wollte mehr sein als ein von Gott beschenkter Mensch. Er wollte mehr als von Gott verliehene Würde – er wollte alles: unbeschränkte Macht, unschlagbare Größe, umfassende Erkenntnis. Er wollte alles, was Gott hatte. Er wollte sein wie er (vgl. 1. Mose 3,1-6). Diese Selbstüberschätzung war der Auftakt zu einem steilen Absturz. Im Zuge dessen hat der Mensch unter anderem seine Verantwortung, sich selbst gut zu führen, von sich gestoßen. Viele Probleme, denen Sie und ich heute in Hinblick auf unsere Selbstführung begegnen, haben hier begonnen.
Verstecken und sich herausreden
Kaum haben die ersten Menschen von der verbotenen Frucht gegessen, verstecken sie sich (vgl. 1. Mose 3,8). Doch Gott findet Adam und spricht ihn an, worauf er das Versteckspiel auf einer anderen Ebene fortsetzt: „Die Frau, die du mir zugestellt hast, sie hat mir vom Baum gegeben. Da habe ich gegessen … Und die Frau sprach: Die Schlange hat mich getäuscht. Da habe ich gegessen“ (1. Mose 3,12-13). Sich verstecken, Ausreden suchen, andere beschuldigen – das sind die wichtigsten Waffen im Arsenal eines Menschen, der aufgehört hat, sich selbst zu führen. Er weist jegliche Mitverantwortung an seinem Schlamassel von sich.
Seither ist jeder Versuch, unser Leben aktiv, selbstverantwortlich und konstruktiv zu gestalten, umkämpft. Der Boden, auf dem unsere Lebens- und Alltagsgestaltung gedeihen sollte, entpuppt sich als steiniger Grund, auf dem allerhand Unkraut wuchert – wie der Ackerboden der ersten Menschen: „Und zum Menschen sprach Gott: Verflucht ist der Erdboden … Mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren … Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen …“ (1. Mose 3,16-19).
Zwei problematische Tendenzen
So begleiten uns Menschen unter anderem zwei Neigungen – beide führen dazu, dass wir aufhören, unsere von Gott geschenkte Fähigkeit zu selbstverantwortlichem Handeln wahrzunehmen. Erstens: Wir neigen zur Passivität in unseren Beziehungen und unseren Aufgaben: „Die anderen sind dafür zuständig, dass es mir gut geht und ich mich gut fühle!“ Wir fordern und erwarten, dass andere uns glücklich machen. Oder schauen wie ein Kaninchen unter dem hypnotisierenden Blick der Schlange hilflos zu, wie andere unsere Rechte mit Füßen treten und uns ausnutzen – um am Ende in Selbstmitleid zu versinken, weil sich böse Menschen uns gegenüber so schlimm verhalten. So erging es Gabi, von der ich einleitend erzählt habe.
Bei der zweiten Neigung verfallen wir ins andere Extrem: Wir fühlen uns für andere auf eine Weise verantwortlich, wie wir es gar nicht sind. Wenn wir merken, dass jemand sich nicht wohlfühlt, meinen wir, etwas dagegen unternehmen zu müssen. Wir deuten Situationen, Blicke, Gefühle, die im Raum stehen, und lassen uns davon unter Druck setzen, nun etwas zur Entspannung der Situation tun zu müssen. Wir bemühen uns ständig darum, dass alle um uns herum auf ihre Kosten kommen. Und wir halten es kaum aus, nichts zu tun, wenn es jemandem offensichtlich schlecht geht. Wir fühlen uns sofort verantwortlich, dieser Person zu helfen.
Doch die negative Extremform unangemessener Verantwortung hat nicht das Helfen als Hauptmotiv, sondern die Ausübung von Macht: Wir beherrschen andere, kontrollieren sie, statt uns selbst; versuchen sie zu steuern, statt uns selbst. Beuten aus, bevormunden, missbrauchen, unterdrücken: die Ressourcen der Schöpfung und unsere Mitmenschen.
In beidem zeigt sich unsere Gebrochenheit, unsere verlorene Fähigkeit, uns selbst gut zu führen. Es ist seltsam und ein Paradox: Bei der schöpfungsgemäßen Selbstführung schützt der Mensch nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch die Gemeinschaft mit anderen und Gottes Schöpfung. Der gefallene Mensch aber hört auf, sich auf diese Weise selbst zu führen. Damit gefährdet er nicht nur sich selbst, sondern auch die Gemeinschaft mit anderen Menschen und die Schöpfung. Solange sich der von Gott ermächtigte Mensch selbst führt, kann Gemeinschaft aufblühen. Unsere Beziehungen finden auf Augenhöhe statt. Wir können uns als gleichwertige Menschen aufeinander einlassen, aber einander auch Freiheit zugestehen. Liebevolles Miteinander trägt unsere Beziehungen – das Wir steht über dem Ich. Sobald wir jedoch unsere Selbstführung aufgeben, zerstören wir das Wir und setzen das Ich auf Kosten der anderen durch.
Vielleicht ahnen Sie inzwischen, weshalb dieses Thema so wichtig ist: nicht nur deshalb, weil Gott uns die Fähigkeit und den Auftrag dazu gegeben hat, sondern auch, weil wir uns diese Aufgabe so gerne rauben lassen. Weil wir in bestimmten Situationen dazu neigen, uns unserer Verantwortung zu entziehen – oder uns in Dinge einzumischen, für die andere verantwortlich wären, nicht wir selbst.
Es ist faszinierend, welche Bedeutung die Bibel dem Thema Selbstführung gibt, nicht nur hier in 1. Mose 1–3. Während es an vielen Orten eher indirekt zur Sprache kommt oder beschrieben wird (etwa bei Jesus), äußert sich im Neuen Testament eine Person besonders deutlich dazu: der Apostel Paulus.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
KAPITEL 4
„GEBT ACHT AUF EUCH SELBST“ –
PAULUS ZUR SELBSTFÜHRUNG
Kein biblischer Autor spricht so direkt von der Aufgabe, sich selbst zu führen, wie Paulus. 8Er tut es dort, wo es um einen hilfreichen, seelsorgerlichen Umgang von Christen untereinander oder um Leitung geht.
Stellen Sie sich folgende Situation vor: In einer Gemeinde wird bekannt, dass jemand einen folgenschweren Fehler begangen hat und schuldig geworden ist. Alle sind schockiert. Sofort steht die Frage im Raum: Wie soll man dieser Person in Zukunft begegnen? Ist es richtig, einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen? Oder muss es Folgen haben, damit deutlich wird, dass ein solches Verhalten nicht dem Evangelium von Christus entspricht? Das sind schwierige Fragen. Christen sind im Verlauf der Geschichte sehr unterschiedlich damit umgegangen. Manche Gemeinden verhängten teilweise drastische Strafen. Die betroffene Person durfte das Abendmahl nicht mehr einnehmen oder musste seine Aufgaben in der Gemeinde abgeben. Andere ließen es gut sein und beriefen sich auf die Gnade beziehungsweise auf die Sündhaftigkeit aller Menschen. In seinem Brief an die Galater schlägt Paulus einen anderen Weg vor:
Geschwister, wenn jemand sich zu einem Fehltritt hinreißen lässt,
dann sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geführt seid, ihn wieder zurechtbringen …
Doch schau dabei auf dich selbst, dass du nicht selbst versucht wirst.
Jeder soll sein eigenes Tun prüfen …
Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben.
Galater 6,1.4-5; eigene Übersetzung
Paulus zeigt: Wegsehen löst keine Probleme und hilft niemandem. Wer über ein Fehlverhalten zu schnell den Zuckerguss der Gnade gießt, der fürchtet sich in Wahrheit davor, einem anderen Menschen Korrektur, und damit letztlich auch Veränderung und Wachstum, zuzumuten. Man soll also über das Vorgefallene sprechen und einen Weg suchen, damit die betroffene Person einen Neuanfang machen kann. Doch noch ausführlicher als über denjenigen, der versagt hat, spricht Paulus nun über diejenigen, die ihm auf den rechten Weg helfen wollen. Das ist erstaunlich. Paulus kennt das menschliche Wesen offensichtlich sehr gut und weiß: Wenn jemand auf die Nase gefallen ist, dann ist nicht bloß er selbst in Gefahr. Die vielleicht größere, meist aber nicht wahrgenommene Gefahr lauert bei denjenigen, die sich um ihn kümmern sollen. Sie besteht einerseits darin, dass man einfach wegschaut und gar nichts unternimmt. Keiner will sich die Finger verbrennen, keiner sich unbeliebt machen. Bei den Galatern scheint diese Gefahr allerdings nicht zu bestehen, sondern eine andere, die genauso problematisch ist: dem Schuldiggewordenen aus einer Haltung der Selbstsicherheit und Überlegenheit heraus zu begegnen. Sie stehen in der Versuchung, sich für besser zu halten und das Geschehene zum Anlass zu nehmen, sich mehr mit den Sünden dieses Menschen zu beschäftigen als mit ihren eigenen Unarten und Abgründen. Und das, so scheint es, wäre das folgenschwerere Versagen. Denn was die andere Person falsch gemacht hat, ist offensichtlich. Das Versagenspotenzial ihrer „Helfer“ aber versteckt sich hinter einer Fassade scheinbarer Frömmigkeit und Selbstsicherheit.
Читать дальше