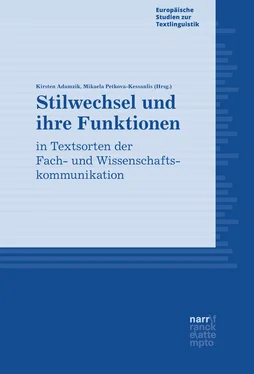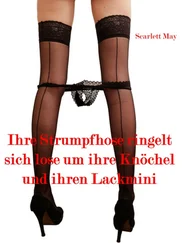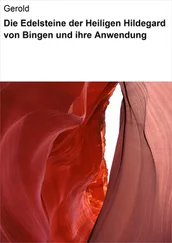Insgesamt ist festzustellen, dass durch den technischen Fortschritt der Kommunikationsmedien auch deutliche Stilwechsel begründet sind: Zum einen der Übergang vom einfachen gedruckten Text zu digitalen Texten, die über technische Optionen der Informationserweiterung verfügen, die eine barrierefreie Kommunikation ermöglichen, die stärker visualisiert sind und zugleich die Echtzeitkommunikation zwischen Autoren und Rezipienten herstellen können. Zum anderen Texte mit Informationseingrenzung durch ‚Chatstrukturen‘ und Symbole, die einen schnellen Informationsaustausch zwischen Sender und einem Rezipienten bzw. der Rezipientengemeinschaft ermöglichen. Die Kommunikation wird stärker adressatenwirksam gesteuert.
Während die Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in gedrucktem Material gut erforscht ist (vgl. z.B. Adamzik 2010; Auer/Baßler 2007; Berg 2018; Conein u.a. 2004; Koskela 2002; Niederhauser 1999), liegen zur digitalen (Fach-) Kommunikation, z.B. zu Blogs, noch verhältnismäßig wenige linguistische Studien vor (u.a. Mauranen 2013; Enderli 2014; Moss/Heurich 2015; Meiler 2018; Schach 2015). Das Forschungsfeld Verständlichkeit von digitaler Wissenschaftskommunikation wurde erstmals durch die Beiträge des Sammelbandes von Bonfadelli u.a. (2016) mit einem Überblick zu den Forschungsfeldern (u.a. Public Understanding of Science ) thematisiert und die Diskursqualität von Online-Wissenschaftskommunikation unter den Schlagwörtern Science for all und Scientific Literacy .
Mit den Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung auf die deutsche Sprache befasste sich im Jahr 2014 eine forsa-Befragung (forsa 2014) unter 100 Sprachwissenschaftlern. Danach geht die Mehrheit der befragten SprachwissenschaftlerInnen (62%) davon aus, dass die zunehmende digitale Kommunikation einen großen Einfluss auf die deutsche Sprache hat. Zu den Bereichen mit besonders starken Auswirkungen gehören:
(1) die Lexik (22% der Befragten verweisen auf die vermehrte Nutzung von Abkürzungen, Floskeln und neuen Wörtern),
(2) die Vermischung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit (22%) sowie
(3) die Veränderung der Grammatik, Rechtschreibung und Interpunktion (19%).
Dass es zu Veränderungen des Kommunikationsverhaltens kommen wird, glauben 17% der Befragten; weitere 17% gehen auch von einem stärker informellen und kreativen Sprachgebrauch aus und die Verwendung von Anglizismen betonen 6%. Insgesamt 39% der Befragten meinen, dass sich die Satzstrukturen vereinfachen; 20% sehen vermehrt gesprochensprachliche Strukturen und 14% vermuten Veränderungen in der Groß- und Kleinschreibung, weniger Interpunktion sowie vermehrt Kürzungen von Endungen und die Nutzung von Abkürzungen (vgl. forsa 2014: 4–6). Betrachtet man die Lexik genauer, so gehen 26% der Befragten davon aus, dass die digitale Kommunikation in diesem Bereich durch die stärkere Nutzung von Neologismen, Anglizismen und von Akronymen geprägt sein wird. Zudem ist von einer Informalisierung und einer Nutzung von mehr bildlichen Sprachelementen (z.B. Symbole, Emoticons) auszugehen.
Leider sehen 27% der Befragten auch die Gefahr, dass sich durch die Nutzung digitaler Medien die Schreib- und Lesefähigkeit verschlechtern könnte; 29 % der Befragten gehen hingegen eher von einer Verbesserung aus, aber 34% sind diesbezüglich noch unentschieden.
Betrachtet man zusammenfassend die Ergebnisse der Befragung, so erscheint es notwendig, die geäußerten Meinungen durch Textanalysen aus verschiedenen digitalen Genres zu verifizieren. Zugleich ist es erforderlich, Stilwechsel als Ausdruck von Sprachdynamik auf den einzelnen Sprachebenen zu dokumentieren. Aus diesem Grund betrachtet der vorliegende Beitrag exemplarisch, welche stilistischen Tendenzen sich in digital veröffentlichten Texten abzeichnen. Dazu wurde ein Korpus aus Texten von Wissenschaftsmagazinen und von Blogtexten zu den Themen ‚Smart Technology‘ und ‚Virtuelle Realität‘ betrachtet.
2 Technikentwicklung und Begriffswelt – Alles smart, oder …?
Naturwissenschaft und Technik sind heute allgegenwärtig und ihre Erkenntnisse oft für fachliche Laien zu komplex. In Zeiten eines starken wissenschaftlich-technischen Umbruchs, der das Leben der Menschen nachhaltig beeinflusst, entsteht ein besonderer Bedarf, Erkenntnisse verständlich in die breite Öffentlichkeit zu transferieren, auch um Ängsten vor diesen Entwicklungen vorzubeugen. Eine solche qualitativ neue Phase der Technikentwicklung wurde durch die Digitalisierung und Automation eingeleitet, über die besonders im Internet berichtet wird und deren Berichterstattung viele Züge der Computerfachsprache und des Journalismus trägt. Die Sprache der Informatik ist schnelllebig, von vielen Neologismen, Anglizismen und Symbolen geprägt; der Sprachstil ist sachlich, kurz und präzise. Im Gegensatz dazu ist die Sprache im Journalismus durch Vergleiche, direkte und indirekte Rede, Beispiele und Metaphern angereichert, was sich auf die Gestaltung der Berichterstattung über IT-Entwicklungen überträgt.
Auf der Online-Plattform www.heise.dewerden die neuesten Entwicklungen im Bereich Computer und Digitalisierung vorgestellt, wobei die Informationen häufig auf englischsprachigen Quellen beruhen. Teilweise erscheinen die dort verbreiteten Mitteilungen auf weiteren Portalen in modifizierter Form, teilweise über unterschiedliche Genres. Oft werden die englischen Fachbegriffe (für die es keine Äquivalente im Deutschen gibt) ins Deutsche übernommen. Ein englischer Fachbegriff gilt als kürzer (daher ökonomischer), ist prestigeträchtiger und der breite Leserkreis (vom Experten zum interessierten Laien) stuft die Darstellung auch so als verständlich ein. Zudem sind die popularisierenden Texte auf deutschsprachigen Online-Portalen bzw. in Online-Ausgaben von Wissenschaftsmagazinen (z.B. Spektrum der Wissenschaft und bild der wissenschaft ) häufig Übersetzungen aus dem Englischen. Diese übernehmen aus den oben genannten Gründen auch oft englischen Fachwortschatz, was gegenwärtig besonders in Texten zu den Themenbereichen Smart World , Virtuelle Realität , Künstliche Intelligenz und Robotik zu beobachten ist. Beispiele dafür sind: Internet of Things ( IoT ), IIoT ( Industrial Internet of Things – Industrie 4.0 ), Smart City , Artificial Intelligence ( AI ) , Virtual Reality ( VR ) , Augmented Reality ( AR ) , Mixed Reality ( MR ) . Die (englischen) Neologismen dringen über die Berichterstattung sukzessive in den Alltag der Menschen vor und bestimmen als Schlagwörter die Art und Weise der Kommunikation über und mit den Dingen. Die Begriffe sind zwar ‚in aller Munde‘, aber hinterfragt man das Verständnis zu einem solchen neuen Begriff, dann offenbaren sich oft Vagheiten und Wissenslücken, weil Neologismen häufig (noch) nicht klar definiert sind. Als Beispiel kann hier der Begriff Big Data genannt werden, der zwar seit einigen Jahren etabliert ist, aber als Schlagwort einem kontinuierlichen Wandel in Bedeutung und Beschreibung unterliegt. Diese Vagheit wird an Textbeispiel (A) deutlich, in dem sprachlich auf das Verständnisdefizit und die Prozesshaftigkeit von Big Data verwiesen wird (vgl. die durch Fettdruck markierten Textstellen). Der Begriff Big Data scheint nicht ins Deutsche übersetzbar zu sein und er durchläuft noch immer den Prozess der Präzisierung/Terminologisierung. Deshalb werden zu seiner Charakterisierung Vagheitsausdrücke (z.B. prinzipiell , eventuell , idealerweise ) verwendet, die zudem auch Ausdruck der Unsicherheit des Autors im Umgang mit dem Begriff sind.
(A) Big Data ist nach einer Reihe logischer Entwicklungsstufen im Internet, wie der Individualisierung, der Verlagerung von Daten in die Cloud und des rapide steigenden Wunsches nach (Digitaler) Mobilität, das neue kontrovers diskutierte Thema. […] Prinzipiell geht es darum, unterschiedliche Datenmengen mit den neuen Datensätzen zu kombinieren, eventuelle Muster in diesen kumulierten Daten mit intelligenten Softwareprogrammen aufzuspüren, um anschließend die richtigen (möglichst wirtschaftlich lukrativen) Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen. Einmal erhobene Primärdatensätze können zu unterschiedlichen Zwecken und für unterschiedliche Akteure zweit-, dritt-, oder x-fach ausgewertet werden. Dadurch erweisen sich die Daten einerseits als Quelle für Innovation, Kreativität sowie „Out-of-the-box-Denken“ und münden idealerweise in neuen Geschäftsideen, Produkten oder Dienstleistungen. (Big Data – Die ungezähmte Macht, 04.03.2014: 3–4, www.dbresearch.de[letzter Zugriff: 31.01.2019])1
Читать дальше