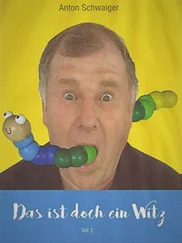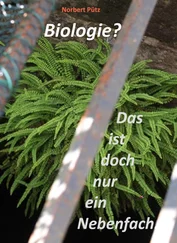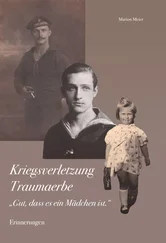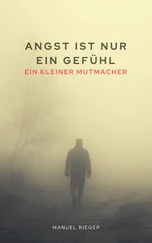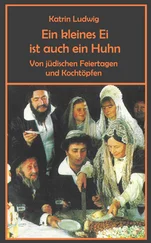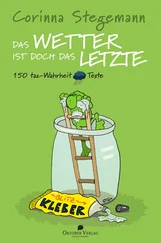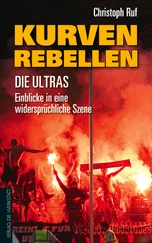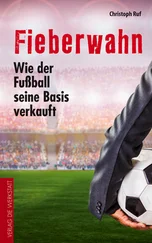»In drei Tagen Europacup«
Beim ersten Aufstieg 1994 profitierte TeBe davon, dass dem Tabellenersten Union Berlin, dem Klub aus dem Oststadtteil Köpenick, die Lizenz wegen einer gefälschten Bankbürgschaft verweigert wurde (woran TeBe unbeteiligt war). Seit stattdessen der Zweite TeBe in die zweite Liga aufstieg, galt man im Ostteil der Stadt als reicher Schnöselverein, der sich als Projektionsfläche für die absurdesten, gerne auch mal antisemitisch aufgeladenen, Verschwörungstheorien geradezu anbot. Dass TeBe schon bald wieder abstieg, wurde zumindest in Berlin-Köpenick mit Genugtuung zur Kenntnis genommen.
Ende der 1990er Jahre wurde dann der kleine, aber seit jeher mit einer feinen Fanszene gesegnete Klub aus Charlottenburg vom Wahnsinn heimgesucht. Mit Hilfe der »Göttinger Gruppe«, einem höchst dubiosen Versicherungskonzern, wollte man in möglichst kurzer Zeit mit Millionensummen in die Bundesliga aufsteigen. Spätestens unter Winni Schäfer, der es so rein gar nicht verstand, lauter hoch bezahlte, meist schon etwas betagte Individualisten zu einem Team zu formen, und noch nach Monaten die Namen der Spieler verwechselte, machte

Kaum einer mag den BFC. Darauf sind sie beim BFC stolz.
man sich bundesweit unbeliebt. TeBe hatte damals in den Fanszenen zwischen Hamburg und München ein ähnliches Image wie die TSG Hoffenheim heute.
Die Pläne des Unternehmens scheiterten, TeBe musste Insolvenz anmelden. Doch das Image weigerte sich standhaft, ebenfalls in Konkurs zu gehen. Endi und sein Kumpel, beides dezidierte Linke, haben sich schon damals über die pauschalen Verurteilungen geärgert: »Es wäre ja schön gewesen, wenn man mal zur Kenntnis genommen hätte, dass die ›Göttinger Gruppe‹ von keiner Seite so viel Druck bekommen hat wie von uns Fans.« Vor allem über eines der besten Fanzines Deutschlands, die Lila Laune, mischten die sich kräftig ein.
Aus Protest zog man von den angestammten Plätzen unterhalb der Haupttribüne auf die gegenüberliegende Seite, der Größenwahn der Investoren wurde mit ironischen Sprechchören karikiert: »Wir steigen auf und niemals ab – in drei Tagen Europacup.« Trotz kurzzeitigen sportlichen Erfolgs – der Aufstieg in die zweite Liga gelang, wo man zunächst auch halbwegs erfolgreich mitspielte – strömten die Zuschauermassen nach wie vor nicht. Etwa 4.000 Zuschauer kamen im Schnitt – das war damals für Zweitligaverhältnisse solides Mittelmaß im unteren Drittel der Zuschauertabelle. Doch verglichen mit der Vergangenheit war das verschwindend wenig. Im Endspiel um die Berliner Meisterschaft 1952 sahen 75.000 Zuschauer im Olympiastadion einen 4:2-Sieg TeBes über Union 06. Auch in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga in der Saison 1973/74 kamen deutlich über 20.000 Zuschauer zu den Heimspielen. Mehr Fans wären Ende der 1990er Jahre durchaus möglich gewesen, doch besonders für die bisherige Zielgruppe, den kritischen Teil der Berliner Fußballfans, war der Deal mit der »Göttinger Gruppe« alles andere als eine Werbemaßnahme.
Die anfänglichen Hoffnungen, man werde doch in einer Riesenstadt wie Berlin wenigstens ein paar hundert Leute in den Block kriegen, zerstoben dann allmählich: Schon im alten Westberlin galt TeBe als irgendwie niedlich, aber rettungslos uncool. Nicht nur wegen des weitläufigen Stadions in einem Stadtteil fernab der Szeneviertel.
Die wenigen, die TeBe zu ihrem Lieblingsverein auserkoren haben, unterscheiden sich jedoch wohltuend von den Fans vieler anderer Vereine. Zum Beispiel dadurch, dass sie die 100-Jahr-Chronik des Vereins zum großen Teil selbst gestalten. Martin Hoffmann und Martin Endemann beschreiben die Stimmung Ende der 1990er Jahre darin wie folgt: »Auf TeBe-Seite stellte sich langsam ein kleiner Haufen Fans zusammen – eine recht amüsante Mischung aus älteren Fans besserer Zeiten und Jugendlichen, die auf Hertha keine Lust hatten. (…) Nach dem Abstieg sollten vier anstrengende Jahre in der neuen Regionalliga Nordost folgen. Egal, ob in Stendal, in Leipzig oder eben bei Erzfeind Union – die TeBe-Fans sahen sich praktisch überall blankem Hass, erstaunlich salonfähigem Antisemitismus und generationsübergreifender Ausländerfeindlichkeit ausgesetzt.«
Auch wenn die Anfeindungen gegenüber TeBe in den letzten Jahren weniger geworden sind – aufgrund seiner eher linken Fanszene, vor allem aufgrund seiner jüdischen Wurzeln wird der Verein, dessen Ehrenpräsident der verstorbene Entertainer Hans Rosenthal ist, noch heute zuweilen zur Zielscheibe dummdreister Rassisten.
»Fast immer bleibt er da«
Doch auch der letzte Satz des Artikels aus der Chronik beschreibt die aktuelle Lage bestens: »Dann und wann findet wieder ein ›Neuer, der vom etwas anderen Verein‹ gehört hat, den Weg zu den Spielen. Fast immer bleibt er da.« Massen an Neugierigen hat man allerdings am Eichkamp noch nie willkommen heißen dürfen – nach all den Jahren gegen häufig unattraktive Gegner, die gerade einmal fünf Fans mitbringen, ist die Strahlkraft des Vereins zuletzt nicht unbedingt gewachsen.
Mancher Fanveteran ertappt sich dennoch hin und wieder bei höchst anschaulichen Tagträumen. Wenn nur einmal 1.000 Zuschauer mehr kommen würden, würde sich das in der trendsüchtigen Metropole schnell herumsprechen, der Schneeball würde ins Rollen kommen. »Ein Bruchteil derer, die in Berlin zu St. Pauli gehen, wenn die in der Stadt spielen … « Endi bringt den Satz nicht zu Ende. TeBe steht eben auf verlorenem Posten, zumal mancher alternativ gesonnene Berliner sich zu Union und vor allem zu Babelsberg aus dem nahen Potsdam hingezogen fühlt.
Auch Hagen Liebing ist schon vor 15 Jahren aufgefallen, wie viele Leute, die so ticken wie er, von Berlin aus ans Millerntor fahren. »Früher gab es von TeBe-Seite aus eine fast schon sklavische Zuneigung zu St. Pauli«, erinnert er sich. Als dann einzelne Hamburger zarte Bande zu Unionfans knüpften, verstand das bei TeBe keiner. Liebing findet das nicht so schlimm: »Hier in Berlin rennen doch Hunderte mit ›Retter‹-Shirt rum, die gar nicht richtig zum Fußball gehen.«

TeBes wohl bekanntester Spieler anno 1927: Sepp Herberger.
Hagen Liebing geht »richtig« zum Fußball. Seit 1974 zu TeBe. Hertha kam für ihn schon damals nicht in Frage: »zu prollig«. Liebing, der später als »The incredible Hagen« Basser der »Ärzte« war, fand dann als Punkrocker auch politisch einige Gründe für die Abneigung gegen den nur zwei S-Bahn-Stationen vom Mommsenstadion entfernten heutigen Bundesligisten. Schon in den 1970ern existierten dort Fangruppierungen wie »Zyklon B«, die sich nicht zufällig so nannten, auch die »Hertha-Frösche« begründeten damals ihren schlechten Ruf. In Berlin waren die Fronten damals klar: Wer politisch nach rechtsaußen tendierte und sich parallel für Fußball interessierte, ging zu Hertha, wer politisch anders tickte, mied das Olympiastadion aus genau diesem Grund.
Heute ist Hertha kein Nischenverein mehr, sondern eine Art Berliner Volkspartei, die Menschen aus allen Bevölkerungsschichten anspricht, doch die alteingesessene rechte Szene fühlt sich hier immer noch am wohlsten. Auch deshalb würde TeBe-Fans die Atmosphäre wohl nicht gefallen. Hagens Vater ging damals zu Hertha, »dann kam der Bundesligaskandal und er blieb zu Hause«. Die Liebings kamen aus Charlottenburg, also wurde TeBe zu Hagens Verein. Doch geographische Gründe allein hätten wohl nicht ausgereicht, um den jungen Hagen zu infizieren: »Als ich lange Haare hatte, gingen mehr Langhaarige zu TeBe als zu Hertha, später, als ich Punkrocker war, waren dann hier die Punkrocker.« Kurzum: Hagen wusste immer, dass er bei seinem Lieblingsverein unter seinesgleichen sein würde. TeBe war einer von vielen Treffpunkten der Subkultur. Nicht dass man unbedingt unter sich bleiben wollte. Aber mangels öffentlichen Interesses war es ein exklusives Schicksal, Anhänger von Tennis Borussia Berlin zu sein.
Читать дальше