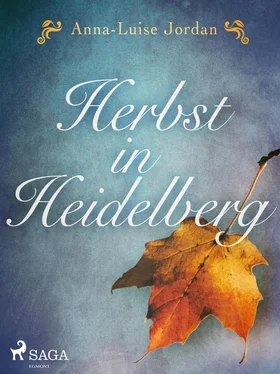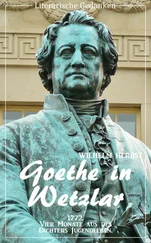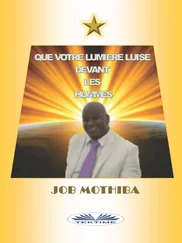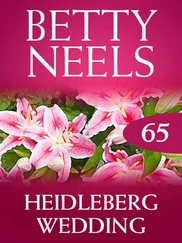Anna-Luise Jordan
Herbst in Heidelberg
Roman über die
deutsche Romantik
Saga
»Komm nach Hause!« In seinem besten Frack stand Karl vor Sophie, den Hut vor den Bauch haltend, weil er sonst mit seinen Händen nicht gewusst hätte, wohin. »So geht das nicht weiter. Komm nach Hause.« Er war es leid, bei den Tisch- und Abendgesellschaften allein die Honneurs des Hauses machen zu müssen. Die Studenten, die trotz Sophies Abwesenheit noch immer regelmäßig zum Mittagessen kamen, fragten viel zu oft, wann die Seele des Hauses denn wieder da sei.
Sophie vermied es, Karl anzusehen, obwohl sein Frack tadellos sauber war und die Haare ordentlich gekämmt, keineswegs selbstverständlich bei ihrem etwas grobschlächtigen Ehemann. Sein fleischig-schlaffes Gesicht ließ nichts von dem Jähzorn ahnen, mit dem er sie in den vergangenen fünf Jahren, selten zwar, doch stets unvermutet, verstört hatte. Sie sah zu Gisela hinunter, die mitten im Zimmer auf dem Teppich saß und mit bunten Klötzchen spielte. Das Licht der Nachmittagssonne, das durchs Fenster fiel, ließ das feine Kinderhaar fast weiß erscheinen. Auf dem runden Tisch daneben stand eine Vase mit Schneeglöckchen aus dem Garten.
»Ich brauche dich. Jeder fragt nach dir, will dich endlich wiedersehen. Was tust du überhaupt hier? Verwandtenbesuche, gut. Aber nicht wochenlang. Monate. Langweilst du dich hier nicht?« Karl schnaubte verächtlich.
Nach dem Tod des kleinen Gustav Anfang Januar hatte Sophie bei ihrer Schwester und dem Schwager Zuflucht gefunden. Hier fühlte sie sich geborgen, doch Karl traf ins Schwarze mit seinem Verdacht der Langeweile. Das Leben in Camburg verlief sehr ruhig, genau das Richtige für überspannte Nerven. In Jena war das Leben aufregend. Es gab Bälle, lebhafte Gespräche in Salons, Theater. Seitdem Sophie im Haus ihrer Schwester und des Schwagers lebte, hatte sie kaum etwas anderes getan, als zu lesen. Sie las die Römischen Elegien und die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten in den Horen , worin auch ein paar Briefe und Gedichte von ihr selber abgedruckt waren, und nahm sich den Wilhelm Meister vor. Alle vier Bände hatte sie gelesen und sich Gedanken dazu gemacht. So musste ein Roman sein. Eine Figur, die sich verändert, eine Vielzahl von Ereignissen und ferne Gegenden. In Jena könnte sie mit ihren Freunden darüber reden. So intelligent und witzig wie Fritz war keiner und niemand so voller Phantasie wie Clemens.
»Ich werde kommen. Aber jetzt noch nicht. Ich brauche noch etwas Zeit.« Hoffentlich sagte Karl jetzt nicht, dass sie sich zusammenreißen solle. Erst vor knapp drei Monaten war Gustav gestorben. Wenn sie Karl auch nicht die Schuld daran geben mochte, so tun, als wäre alles wie vorher, konnte sie nicht. »Bitte geh jetzt. Gisela ist zu empfindlich für eine Reise in dieser Kälte. Wir bleiben hier. Mindestens bis Ostern.«
Mitte April saß Sophie in der Kutsche mit Gisela auf dem Schoß. Die Bäume entlang der Straße zeigten erstes Grün. Büsche und Zweige blühten weiß und gelb. Die Saale glitzerte im Sonnenlicht. In einiger Entfernung erhoben sich die kahlen Felsen und Weinberge, wo seit Jahrhunderten Wein angebaut wurde. Bei Gründung der Universität hatten die Studenten durchgesetzt, ein eigenes Gasthaus zu bekommen. Noch immer behaupteten die Bürger von Jena eigenwillig ihre Rechte und achteten nicht groß auf den Willen der verschiedenen Herzöge, die hier das Sagen hatten, vier zugleich und darum keiner wirklich.
Die Unruhen, die noch vor fünf Jahren unter den Studenten tobten, hatten sich mittlerweile gelegt. Fenster wurden keine mehr eingeschlagen. Leider hatte Professor Fichte die Universität verlassen. Sophie wäre gerne weiterhin in seine Vorlesungen gegangen, an denen sie als einzige Frau teilnahm. Sie würde ihn vermissen, zumal auch Professor Schiller mit seiner Familie im Dezember weggezogen war. Historiker war er nur in zweiter Linie, man kannte ihn vor allem als Dichter und Dramatiker. Und für Sophie war er Freund und Förderer. Auch ihn würde sie vermissen. Zum Glück war der Weg nach Weimar nicht allzu weit. Sophie liebte es, mit ihm über Poetik und die Freiheit zu diskutieren. Mit Karl, Juraprofessor ohne Humor und Esprit, konnte sie das nicht.
Die Kutsche erreichte das Stadttor. Sophie fand die Straßen öde, die Fassaden der Häuser abweisend und das Haus, in dem sie mit Karl lebte, hohl und kalt. Mit dem Ende des letzten Jahres hatte nicht nur ein Jahrhundert sein Ende gefunden. Eine Welt war untergegangen. Gleich zu Beginn des neuen Jahrhunderts ihren kleinen Sohn verloren zu haben schmerzte viel mehr als jeder andere Verlust. Aber Kinder starben, das war normal. Jede Familie kannte das.
Beim Neujahrsball hatte Sophie ausgelassen getanzt. Sie hätte zu Hause bleiben sollen. Clemens gab Karl die Schuld. Aber hätte sie nicht bei dem kranken Kind bleiben müssen, anstatt sich mit Clemens und den anderen zu amüsieren?
Sophie und Gisela wurden herzlich empfangen. Jette, ihre ältere Schwester, freute sich und umarmte sie beide. Karl rieb sich vor Zufriedenheit immer wieder leise brummend die Hände. Das Hausmädchen und die Köchin hatten sich extra frische Schürzen umgebunden und strahlten.
Am nächsten Tag saß Sophie genau wie im letzten Jahr am Tisch zwischen Karl und Jette zusammen mit den Studenten und täglichen Mittagsgästen. Anders als im letzten Jahr jedoch sprach Sophie fast gar nicht und nur selten lächelte sie. Clemens, bezaubert vom Nimbus aus Trauer und Entsagung, der sie umgab, wandte seinen Blick keine Minute von ihr. In den Augen des jungen Medizinstudenten schien ein dunkles Feuer zu brennen. Wenn Fritz dieses Leuchten in seinen Augen bemerkte, witzelte er: »Seht mal, er brennt, brennt an, wenn er nur nicht abbrennt.« Solche durchaus eine Spur boshaft gemeinten Spielereien mit seinem Familiennamen parierte Clemens meist geschickt und einfallsreich.
»Der junge Herr Brentano scheint in ein Traumbild versunken und wirkt gleich selbst wie eines«, flüsterte Jette Sophie zu, laut genug, dass es jeder am Tisch hörte. Sophie schaute Clemens an. Schwarze Locken umspielten seine helle Stirn und in seinem Schweigen kam er ihr wie die Statue eines griechischen Jünglings vor. Neben ihm saß Stefan. Er stieß Clemens an: »Steif wie ein Ölgötze sitzt du da. Sag mal was. Lernen wir nachher zusammen noch ein bisschen Physiologie?« Stefan studierte wie Clemens Medizin. Er dachte ans Examen, Clemens dagegen mied zum Ärger seiner Familie in Frankfurt den Anatomiesaal und besuchte kaum eine Vorlesung. »Physiologie?« Er verzog das Gesicht. »Poesie, mein Lieber, Poesie macht das Leben aus, nicht Physiologie.« Damit war das Stichwort gefallen. Mit Gesprächen über Dichtkunst und Romane verbrachten die Freunde ihre Zeit am liebsten. »Fritz behauptet, moderne Poesie muss alles umfassen und sich mit Philosophie und Rhetorik berühren«, meinte Stefan, »vielfältig und bunt soll ein Roman sein, ein großartiges Bild aus verschiedensten Teilen und allen Gattungen gemischt.« »Schade, dass er nicht hier ist«, sagte Sophie. Clemens’ Augen erglühten wie zwei Kohlen in heißer Asche. Ob aus Eifersucht oder Überraschung, weil sie ihr Schweigen brach, konnte Sophie nicht deuten. »Schweifende Willkür, Verirrung im Labyrinth der Gefühle«, rief Clemens, »meinetwegen auch Philosophie, wie du behauptest. Das kann bestimmt nicht schaden. Aber ohne Ironie geht es gar nicht.« »Meinst du?«, fragte Stefan. »Ja. Ironie im Bewusstsein des unendlichen Chaos, Agilität im permanenten, allumfassenden Wandel.« Er breitete die Arme aus und stieß dabei an Stefans Schulter. Dieser zog skeptisch die Augenbrauen hoch: »Das hört sich nach einem größeren Programm an, oder ist das Ironie?« Jette lachte auf und Sophie musste lächeln. Sie erwähnte
Читать дальше