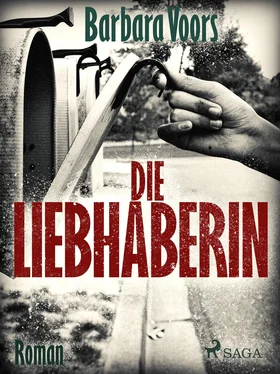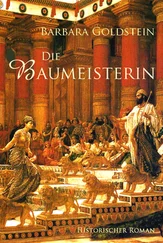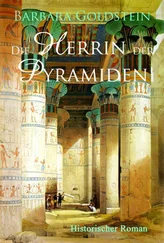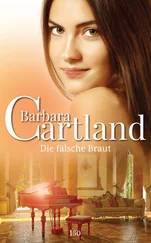Sie hört sich an wie eine Strafgefangene bei ihrem ersten Ausgang.
»Mir ist, als wäre ich zwei Wochen nicht aus dem Haus gewesen«, fährt sie fort und hält mir die Autotür auf.
»Anstrengend«, erwidere ich mit einem Nicken.
»Nicht, daß ich klagen will.«
»Nein, Gott bewahre.«
Darüber lachen wir. Sie hat ein schönes Lachen, ist übrigens eine sagenhaft schöne Frau, das sagte Herman zu ihrem Mann Johannes, der seit gut einem Jahr mein Kollege im Orchester ist.
Ich fange an zu lamentieren, das tue ich immer, wenn ich mit Kristin zusammen bin. Über Rosannas störrische Art, über Hermans Abwesenheit und dann über Marvin, von dem ich behaupte, ich könnte nicht über ihn reden, aber natürlich tue ich es dennoch.
»Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, Molly«, sagt sie mit einem Blick in den Rückspiegel, wobei sie die Spur wechselt, um auf die Autobahn abzufahren, »keiner von uns kann alles bewältigen.«
Außer dir, denke ich mürrisch.
»Wer hat von schlechtem Gewissen geredet?«
»Niemand. Ich hatte nur den Eindruck.«
»Wer hat herumgeschrien, er möchte früher aus dem Haus kommen?« erwidere ich rasch.
Immer dasselbe: Ich öffne die Tür sperrangelweit, werde übertrieben privat, und dann ziehe ich sie krachend zu, klemme Finger ein. Keiner kommt mir hier herein. Wir fahren schweigend weiter.
»Habt ihr auch so einen merkwürdigen Zettel über die Midlife-crisis bekommen?« bemühe ich mich.
» An alle Mitmenschen in Sjövik? Gibt es da so viele? Mitmenschen, meine ich. Vielleicht hat sie gerade das gemeint.«
»Sie?«
»Ich fand, es sah aus wie die Schrift einer Frau. Aber was weiß ich.«
»Rede weiter«, sage ich, überrascht von meiner eigenen Aufforderung. »Was hast du noch gesehen?«
Sie denkt nach.
»Daß diese fliegenden Menschen mich an eine Ausstellung erinnerten, die ich mal in London gesehen habe. Es waren Zeichnungen, die von Patienten deutscher Nervenheilanstalten aus den vierziger Jahren stammten. Darunter gab es schmucke, exakte kleine Kalender, in denen ein Patient alle künftigen Daten und Wochentage für hundert Jahre im voraus berechnet hatte. Dieser Zettel hat mich an die Ausstellung erinnert«, sagt sie mit einem Schulterzucken.
»Und der Text?«
»Über den habe ich nicht viel nachgedacht. Irgendwas über die Midlife-crisis. Das wirkt ein bißchen ... weit weg«, sagt sie.
»Ich verstehe. Weit weg, das ist natürlich der richtige Ausdruck.«
Wir parken neben der Konzerthalle. Vor unseren Füßen liegt der große Platz, in der Winterkälte senkt sich das Grau der Statue auf uns herab. Kristin eilt zu ihrer Arbeit, und ich gehe in den Marmorsaal, die Brüste der Figuren zeigen in meine Richtung, im Hintergrund übt jemand eine Tonleiter. Johannes Roberts ist seit langem vor Ort: groß, gut aussehend und liebenswürdig auf eine so passende Weise, daß es zuweilen unpassend erscheint. Er besitzt einen welpenhaften Charme, dieses leicht Hilflose, das dennoch immer korrekt ist. Er wirkt ständig verwundert: daß er eine so schöne Frau hat, so nette Kinder, die Villa in Sjövik und seine Arbeit. Als würde er mitten in all dem mit großem Erstaunen aufwachen, was ihn hin und wieder danebengreifen läßt. Im Orchester werfen ihm viele Frauen verstreute bewundernde Blicke zu, ein Solotrompeter mit solchen Oberarmen und einem Waschbrettbauch.
Johannes hat sich vor der Begegnung mit dem Dirigenten eingespielt. Er ist noch jung, denke ich mit gewissem Sarkasmus und schäme mich. Wir nehmen jeder eine Tasse Kaffee und setzen uns schweigend. Ich gähne, wir haben nicht viel gemeinsam außer der Musik, und auch die kaum.
Im selben Moment überfällt es mich. Dasselbe Gefühl wie beim Lesen des kopierten Zettels: Unruhe und Übelkeit. Ich blicke in die Kaffeetasse, als sei die Antwort darin zu finden. Ich schlucke und schlucke, als hätte ich Gras im Hals.
»Molly, Liebe, was ist mit dir? Bist du krank?«
»Nein, überhaupt nicht. Es ist nur ...«, ich suche nach geeigneten Worten, »irgendwas stimmt nicht.«
Etwas im Augenwinkel, ich drehe mich hastig um. Niemand dort. Jemand in Schwarz, etwas ist dort gewesen . Ich schüttle mich.
Johannes legt seine Hand auf die meine, die Übelkeit verschwindet. Statt dessen ein leichtes Schwindelgefühl, wir holen beide rasch Luft. Seine Hand, mein Blick in seinem Blick. Dann ist sie da: die Begierde. Sie überrascht uns beide, wir stehen auf, Tassen kippen um, und wir murmeln etwas von Probe und gehen auseinander.
Eiskaltes Wasser über heiße Wangen. Das Überraschendste von allem? Hatte es sich so angefühlt? Ewigkeiten her, ein Erwachsenenleben lag dazwischen. Ein schmerzliches Gefühl des Verlustes. Ich hatte es vergessen: Der wichtigste Bestandteil der Begierde ist die Freiheit. Ein überwältigendes Gefühl von Freiheit.
Ich sinke auf einen Stuhl im Frauenumkleideraum der Konzerthalle. Denke zurück an das Kaffeetrinken mit Johannes. Es war wie ein Fieber, denke ich verwundert, das meinen Körper durchfuhr und mich aufgewühlt zurückließ, bevor es zum nächsten weiterzog. Unsere Stimmführerin, die erste Cellistin Marianne, ist eine schmale, ältere Frau mit harter Stimme. Sie kommt herein und wirft mir einen kurzen Blick zu. Sie ist zum Teil für die Leistungen von uns Cellisten verantwortlich. In letzter Zeit erschien sie mir irgendwie wachsam, als hätte sie mich besonders im Auge.
»Mir geht es gut«, sage ich nachdrücklich, sie hat nichts gefragt. »Was proben wir heute?« fahre ich fort, bin mir aber sofort peinlich bewußt, daß ich längst geübt haben sollte. »Ich meine, was nehmen wir als erstes ?«
»Wir werden einen Trauermarsch spielen«, antwortet sie kurz, »Mahlers fünfte.«
»Natürlich«, sage ich und gehe hinaus, um das Cello aus dem Instrumentenschrank zu holen.
Sie kommt hinterher. Eine kurze Aufforderung ertönt aus dem Lautsprecher: »Zur Orchesterprobe auf der Bühne Platz nehmen.«
»Wie steht es, Molly? Du scheinst Schwierigkeiten zu haben, dich ... zu konzentrieren.«
»Es ist wegen meinem Sohn Marvin. Und vielleicht auch wegen meiner Tochter, Rosanna, ja, du weißt.«
Ich verstumme, als ich ihren irritierten Blick sehe.
»Du meinst die Arbeit. Nur eine Flaute. Du hast selber gesagt, es gibt bessere und schlechtere Tage.«
»Freilich. Sieh nur zu, daß jetzt die besseren kommen«, sagt Marianne.
Erst als wir schon auf der Bühne sind und auf unseren roten Samtstühlen direkt vor dem Dirigentenpult Platz genommen haben, verstehe ich die Warnung. Auf der linken Seite, schräg vor uns sitzen die zweiten Geigen, rechts die ersten Geigen und dazwischen die Bratschen. Einige Plätze schräg hinter mir sitzt Johannes mit seiner Trompete. In meinem Rücken befinden sich außerdem die Holz- und Blechbläser, weiter hinten die Schlagzeuge und seitlich davon die Harfe, und zuallerletzt folgen die Kontrabässe.
Der Konzertmeister erhebt sich, und wir stimmen die Instrumente. Dann betritt unser Chefdirigent Maarten van Eijken den Raum, ein höflicher Mann in den Sechzigern, mäßig ehrgeizig (für mich genau richtig), der seit fünf Jahren in der Stadt wohnt. Sehr freundlich, erhebt nie die Stimme, was auch gar nicht nötig ist. Das Orchesterleben kennt keine demokratischen Abstimmungen oder Ausbrüche, zumindest nicht hier auf der Bühne. Dirigenten sind oft etwas langhaarig, damit die graue Mähne im Takt der Musik schwingen kann. Ansonsten erscheinen sie in schwarzer Hose und Rollkragenpullover, das ist auch Hermans Alltagsuniform. Im Orchester sitzen allerlei Männer mit Brille, Bart und schütterem Haar, die jüngeren sind frischere Kopien der älteren. Die meisten jüngeren Frauen sind auf eine seltsam nichtssagende Weise schön, und die älteren wirken proper und irgendwie gut gehalten.
Читать дальше