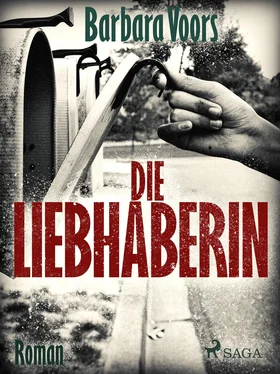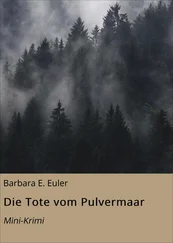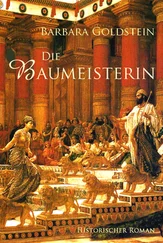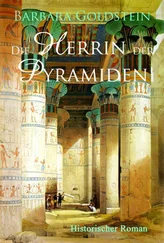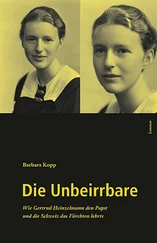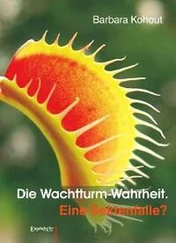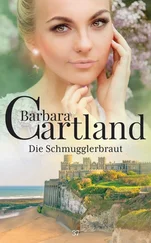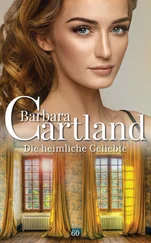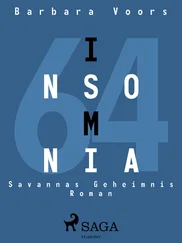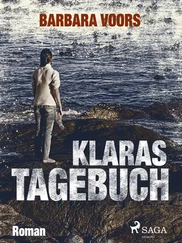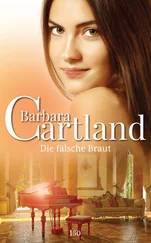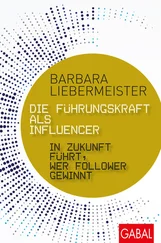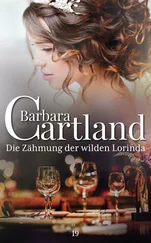Angefangen habe ich als eine Art Wunderkind. Eine Fünfjährige, die am Klavier saß und mit Leichtigkeit Mozart spielte, absolutes Gehör und baumelnde Beine in roten Sandalen. Es wurde geklatscht. Außerdem wie süß, mit diesem rabenschwarzen Haar. Meine Eltern trugen mich durch die Salons, selten streiften meine Füße den Boden. Doch seltsamerweise ist es mit dem Talent wie mit meinem alternden Körper: Die Paßform stimmt nicht mehr. Es war, als wenn ich in ihm nicht zur Reife gelangen konnte, und ich ahne, daß ich aus Faulheit und Selbstüberschätzung meine Gabe nie richtig verwaltet habe.
Ich sagte, daß meine Eltern mich getragen haben. Das taten sie auf jede erdenkliche Weise. Entzückt und verzaubert von diesem Talent, in die Welt gesetzt von unmusikalischen Eltern, bereiteten sie mir einen Platz im Leben. Sie gingen vor mir her und bahnten mir den Weg, schnitten die Dornen ab. Nichts, woran man sich stechen konnte. Privatschulen, ausgewählte Lehrer und ständige Rückenstärkung. Ich ging zum Cello über, was noch besser lief. Eine Karriere als Solistin lag vor mir, so hieß es. Ich wurde getragen und übte, übte und wurde getragen. Sicherheitshalber gaben mir meine Eltern frühzeitig ein Erbe, genau so viel, daß ich mich nie um Geld kümmern mußte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden man in einem Kiosk stehen muß, um das Geld für eine Reise beisammen zu haben. Theoretisch weiß ich es schon, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich ahnte nicht, wie schädlich dieses Nichtwissen sein kann.
Ich sagte, ich wurde getragen, emporgehoben ist ein besseres Wort. Ich wurde über und durch das Leben gehoben. Vermutlich ist es dasselbe wie bei der Leidenschaft. Das Leben ist mir immer widerfahren, ich bin nie selbst darauf zugegangen. Dinge sind geschehen, und ich habe sie geschehen lassen, meine aktiven Entscheidungen sind gering an der Zahl. Kreuzten irgendwelche Möglichkeiten meinen Weg, stellte ich mich in die richtige Richtung, um mitgesogen zu werden, und wenn jemand die Tür zuschlug, habe ich aufgepaßt, daß ich auf der richtigen Seite landete.
Als Zwanzigjährige bewarb ich mich beim traditionsreichen Orchester der Konzerthalle als Cellistin und wurde angenommen. Davor hatte man schwierige Prüfungen hinter Stellwänden abzulegen, ich übte schändlich wenig und wurde sofort für ein Probejahr eingestellt, das ich spielend bewältigte. Der Gedanke war wohl, daß ich Erfahrungen sammeln und dann meine Karriere als Solistin fortsetzen sollte, doch waren das die Ambitionen meiner Eltern, nicht meine eigenen. Ich bin nie ehrgeizig gewesen und ahnte frühzeitig, daß mein Talent eins von der verblassenden Art ist. Noch einmal: Mir widerfahren Dinge, aber ich gehe nicht auf sie zu. Ich bin nicht wie Herman, ich bin kein Aufsteiger. Also blieb ich im Orchester mit seinen festen Anstellungen und seiner Sicherheit. Ein paar vielbeachtete Auftritte als Solistin hatte ich hinter mir, und die hatten stets ein gewisses Sättigungsgefühl erzeugt. Die Scheinwerfer wurden schließlich wieder ausgeschaltet, und wie lange reichte das Lob anderer? Ich hatte keinen Ehrgeiz, so wie Herman ihn hatte. Und ich mußte auch niemanden versorgen, kein ganz unwichtiger Umstand.
Als ich einundzwanzig war, starben meine Eltern bei einem Autounfall, und damit trieb mich niemand mehr an. Das Orchester wurde meine Familie, und ich hatte Freude am Spielen, alle anderen Pläne wurden ad acta gelegt. Und dann kam Herman. Er war zielbewußt, ich war seine junge Trophäe, und wir hatten einen Hof um uns herum, der wie ein bequemes Schutzdach wirkte. Uns machte der Regen nicht naß, uns sollte es an nichts mangeln. Kann man von einem vergeudeten Talent sprechen? Ich übe nur gerade so viel, wie notwendig ist. Was mich beklommen macht, sind die Blicke der neuen Musiker. O, ich weiß genau, was sie denken. Wenn man mich heute hinter dieselbe Stellwand zum Probespielen für meinen Orchesterplatz setzte, käme ich dann überhaupt bis in die zweite Runde?
Ich habe keine Ahnung, wohin das führen soll, daß man sich in den eigenen Schwächen wälzt, zumal ich wohl mehr über mich weiß, als Rosanna zu glauben scheint. Doch im Unterschied zu den jungen Leuten unter Zwanzig habe ich keine Freude daran, die Dinge zu drehen und zu wenden. Was mich beunruhigt, ist das Bild, das ich von mir selber habe. Mir scheint: Je mehr ich schreibe, desto schwieriger wird es, daran festzuhalten, daß ich eine gute Mutter, eine erfolgreiche Musikerin und eine glückliche Ehefrau bin.
Die Musik führte Herman und mich zusammen, das habe ich wohl schon gesagt. Noch bevor die Leidenschaft uns packte, was sie eigentlich sofort tat. Ich glaubte, daß unsere leidenschaftliche Liebe genauso lange währen würde wie die zur Musik. Jetzt bin ich mir bei keiner von beiden mehr sicher. Aber ich glaube, daß die Musik eine Sehnsucht nach Schönheit und Vollendung ausdrückt, die, wie wir wissen, das Leben nie bieten kann – außer in den großen Momenten. Man sucht die Nähe zur Musik, in der Hoffnung, diese Augenblicke wiederzuerhalten, einen Schimmer vom Paradies. Und wir Musiker sind dabei der verlängerte Arm der Schönheit und bezahlen einen Preis dafür: Tinnitusprobleme, Schmerzen in Rücken und Schultern sowie bei einigen von uns eine verschlissene Lippenmuskulatur. »Ergonomischer Wahnsinn«. Mit dieser Bezeichnung beschrieb ein älterer Kollege einmal das Leben in einem Orchester. Kraß, dachte ich, aber vergaß seine Worte nicht. Oftmals habe ich gedacht, daß es mit der Musik wie mit der Liebe ist: Bestenfalls besteht sie aus einer Abfolge von Bewegungen, die ein tiefes Glücksgefühl erzeugen, andere Male wieder ist sie ein wildes Durcheinander von Mißverständnissen und falschem Tempo, bei dem die Bewegungen, die wir in der Hoffnung auf Nähe ausführen, meist nur Lächerliches ergeben.
Aber noch immer berührt mich die Musik tief. Manchmal, wenn ich spielfrei habe und die Garderobenfrauen im Foyer sehe, die mit geschlossenen Augen das Spiel des Orchesters über Kopfhörer verfolgen, dann packt sie mich. Sie hebt mich empor von dem Platz unter den Marmorsäulen, wo ich stehe, führt mich weit weg. Aber dann verklingt das Tönen, ich bin zurück am selben Ort, öffne die schweren Glastüren der Konzerthalle zum Markt mit der kolossalen Skulptur und lasse die Musik hinter mir.
Ich höre es draußen auf der Straße hupen, es ist das Auto, das mich in die Stadt mitnehmen wird. Kristin Roberts steigt aus und winkt. Langes blondes Haar zu einem Büschel hochgebunden, 32 Jahre alt und zwei kleine Kinder irgendwo zwischen zwei Jahren und den ersten ausgefallenen Milchzähnen. Wenn wir uns sehen, scheinen die Arme der Kleinen geradezu um ihren Körper festgezurrt. Wie sie es nur packt. Wie habe ich es nur gepackt! Wir verdrängen, ja verdrängen sogar, daß wir es tun. Aber Kristin sieht großartig aus, dieses strahlende Lächeln.
»Die Kinder«, sagt sie immer, als würde schon das Wort allein Kursivschreibung erfordern. Sie sind ihr ein und alles, will sie damit sagen. Ich bin beeindruckt und erschrocken, beides zugleich. Sicher habe auch ich geliebt, aber so ...
Kristin bewegt sich vor einem Hintergrund von Brei, der ist zu sehen, wenn wir uns treffen, Flecke von Aufgestoßenem, und ich will nicht wissen, wovon sonst noch, auf ihrer Schulter. Sie springt bei einem professionellen Chor ein, der ab und zu mit unserem Orchester singt. Sie hat eine phantastische Stimme; nutzt sie nur nicht völlig. »Die Kinder kamen dazwischen«, so sagt sie. Es ist kein Jammern, nur eine Feststellung. Dafür bewundere ich sie. Eigentlich ist sie meine einzige Freundin hier draußen, ich sollte sie ordentlich festhalten. Ich behandle sie wie eine kleine Schwester, mal mit Liebe, dann wieder lasse ich sie meine Macht spüren. Wie ich es auch bei meinen anderen wenigen Freunden tue.
»Mal rauszukommen!« ruft sie und umarmt mich kurz.
Читать дальше