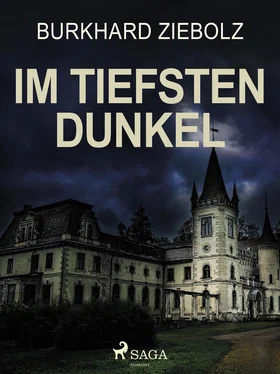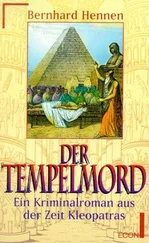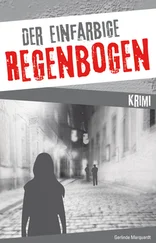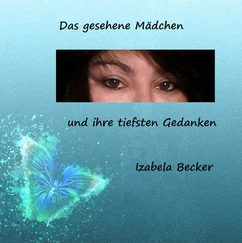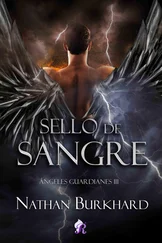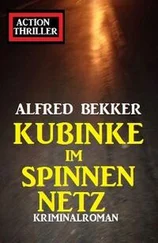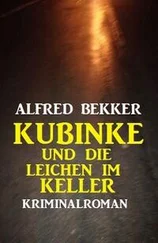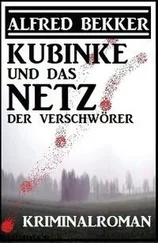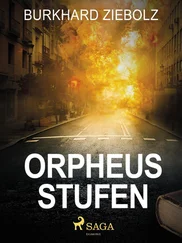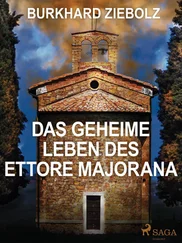A: Das wissen Sie aber nicht. Was machte der Mann denn allgemein für einen Eindruck auf Sie?
T: Der Verdächtige wirkte die ganze Zeit über keineswegs so schlaftrunken, wie es die späte Stunde nahegelegt hätte. Er schien hellwach und hatte seine Sinne beisammen. Auf meine Frage nach der Identität des Anrufers antwortete er: »Ich weiß es nicht.« Dabei wirkte er aber so, als hätte er zumindest eine Ahnung. Comina fand dann den Ohrring. Er sah eindeutig so aus wie der andere, den wir im Falle Elsa Trevi bei der Leiche gefunden hatten. Comina zeigte ihn mir, indem er das Schmuckstück mit seinem Körper gegen die Blicke des Verdächtigen abschirmte.
A: Guter Mann, der Comina. Der Verdächtige konnte den Schmuck also nicht sehen?
T: So dachte ich zunächst. Wenn ich mich allerdings jetzt darauf besinne, dann hätte er es vielleicht doch gekonnt. Wie schon gesagt, stand ich dicht bei der großen Fensterscheibe. Ich denke, dort hätte sich der Schmuck spiegeln können. Wie auch immer – ich wies Comina und Benelli an, weiterzusuchen. Den Verdächtigen forderte ich auf, sich anzukleiden. Er kam der Aufforderung nach, erhob sich und suchte einige Kleidungsstücke im Zimmer zusammen. Dann bat er mich, sich im Badezimmer umkleiden zu dürfen. Ich gestattete dies unter der Voraussetzung, dass die Tür dabei offen bliebe. (handschriftliche Anmerkung am Rande der Akte: Widerspruch zu Aussage Benelli vom 13. Mai 1992).
A: Sie hatten den Mann also die ganze Zeit über im Blickfeld? T: Anfangs schon. Dann aber nahm die weitere Suche meiner Mitarbeiter einen Teil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch. Er war zu diesem Zeitpunkt schon vollständig angezogen und packte gerade einige Toilettensachen ein. Ich war, wie gesagt, einen Moment lang abgelenkt – genau da fiel die Tür zu. Ich reagierte sofort, sprang hinzu und versuchte sie wieder zu öffnen. Benelli und Comino unterstützten mich dabei. Der Riegel hielt allerdings, und wir konnten nichts ausrichten.
A: (unverständlich).
T: Wie? Natürlich. Ich erkundigte mich sofort beim Portier, ob das Bad ein Fenster hatte und wohin es ging. Er gab an, dass es zum Garten hinausging. Ich schickte Benelli sofort nach unten, damit er unter dem Fenster Posten beziehen konnte. (handschriftliche Anmerkung am Rande der Akte: ebenfalls Widerspruch zu Aussage Bennelli) Allerdings war ich wegen der Lage des Zimmers im zweiten Stock und der Tatsache, dass die Etagen Altbauhöhe hatten, beinahe sicher, dass hier eine Flucht nicht möglich war.
A: Was offenbar ein Trugschluss war.
T: Das muss ich leider einräumen. Als Benelli unten ankam, war der Verdächtige schon fort. Er hatte einen neben dem Haus stehenden Baum als Fluchtweg nach unten genutzt. An diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht.
A: (unverständlich)
T: Ja, leider. Die weitere Durchsuchung des Zimmers am folgenden Morgen ergab, dass es ihm gelungen war, sein ganzes Geld und die Personalpapiere mitzunehmen. Unsere umgehend eingeleitete Fahndung hatte keinen Erfolg, er war offenbar innerhalb sehr kurzer Zeit sehr weit gekommen.
Anm. des Protokollanten: Weitere Ausführungen s. Einvernahme Trussardi zum Verlust seines Dienstfahrzeuges, Novo Ligure, 22.Mai 1992
Nach seinem Stadtspaziergang war Liam Coubert in den Turm zurückgekehrt. Nach dem ganzen Durcheinander und den Ungereimtheiten hatte er das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit entwickelt, und wenn es einen Platz gab, wo er beides bekam, dann war das seine kleine Wohnung im Wasserturm, mitten in der Innenstadt und doch ganz weit von ihr entfernt.
All das Seltsame der letzten Stunden – das Foto und wie es seinen Weg zu ihm gefunden hatte, der Anruf von Kringel, dem Auktionator, er selber, Coubert, mit der Frau des Mannes mit den grauen Haaren – war rätselhaft und aus seiner Sicht nicht zu erklären. Er war nicht geneigt, es für Zufall oder eine Aneinanderreihung seltsamer Ereignisse zu halten. Im Gegenteil, er wollte der Sache auf den Grund gehen. Irgendwer hatte gewollt, dass er das Foto bekam, und diesen jemand musste er finden. Vielleicht fand sich in dem Buch noch irgendwo ein Hinweis.
Er öffnete die Metalltür. Er besaß einen von insgesamt drei Schlüsseln zum Turm, die anderen beiden lagen sicher verwahrt bei der zuständigen Dienststelle der Stadtverwaltung. Langsam kletterte er die vielen Stufen der Treppe hinauf, betrat die Wohnung und sah sich um.
Er besaß nur wenige Möbel, und sie waren ein Sammelsurium origineller, neuer und alter, teilweise antiker Stücke. Nichts passte richtig zum anderen. Dennoch ergänzten sich alle Komponenten, keine wollte der anderen die Schau stehlen.
Das Buch lag noch da, wo er es hatte liegen lassen, auf einem Nähtischchen des späten neunzehnten Jahrhunderts, das er für wenig Geld einem Antiquitätenhändler aus Ludwigshafen abgerungen hatte. Coubert schlug das Buch auf. Seite für Seite blätterte er sich vorwärts. Die Handschrift war klein und akribisch und einigermaßen gut zu lesen. Er hatte das unbestimmte Gefühl, dass der Text von einer Frau geschrieben worden war, ohne dass er dieses Gefühl hätte begründen können. Er las quer, die Jahre in der Legion hatten ihn eine schnelle Auffassung des Französischen gelehrt. Je mehr er las, umso mehr nahm ihn der Text gefangen. Er begann, genauer zu lesen, nicht mehr nur oberflächlich. Dann las er Wort für Wort, Silbe für Silbe, und eine neue Art Aufregung nahm ihn gefangen und lenkte ihn etwas ab von der anderen, persönlichen, die das Foto initiiert hatte.
Die Namen aus dem Grafen von Monte Christo tauchten in anderen Zusammenhängen auf als im Original von Alexandre Dumas. Auch die Schauplätze waren andere, teilweise tauchten italienische Ortsnamen auf, und mit Fortschreiten der Geschichte auch immer mehr deutsche und elsässische. Es las sich wie etwas, das vielleicht die Quelle für den Grafen hätte sein können, oder wie eine Variation des Stoffes, die später entstanden war.
Thema con variazioni.
Nach einer Weile stieß er auf eine Bleistiftanmerkung im Text. Die Stelle war eine Ortsbeschreibung, ein kleines Dorf in der Pfalz, irgendwo zwischen Mannheim und Straßburg. Der Ortsname war nicht genannt. Das war seltsam, denn eigentlich hätte das doch die Kerninformation sein sollen, die Basis. Coubert hatte den Eindruck, der Autor würde den Namen der Ortschaft ganz bewusst umgehen, so wie ein später Wanderer den Ort eines grauenhaften Verbrechens meiden würde. Die Beschreibung war mit einem Stern markiert, fünfzackig in der Art eines Pentagramms. Er erinnerte sich, blätterte schnell ans Ende des Buches. Dort, wo das Bild eingeklebt gewesen war, war ein Zwilling des Sterns aufgemalt. Coubert hatte es wegen der Aufregung mit dem Foto fast vergessen.
Wenn wirklich hinter all dem ein Sinn lag, war das ein Hinweis. Er sagte ihm zumindest, dass das Bild und die Textstelle miteinander zu tun hatten. Vielleicht gäbe es an dem bezeichneten Ort etwas, das ihn weiterbrachte.
Im besten Fall bezeichnete die Textstelle den Ort, an dem das Bild gemacht worden war.
Der Geruch. Wenn nur der Geruch nicht wäre. Mit den Bildern kam sie zurecht, in all den Jahren hatte sie sich an Blut, Mageninhalt und Hirn gewöhnt. Aber der Geruch störte Susanne Findeisen immer noch. Es waren Lösungsmittel, Desinfektionsflüssigkeiten, und darunter, gut verdeckt aber immer vorhanden, meinte sie noch etwas anderes, etwas Süßliches wahrnehmen zu können. Es drang ihr in die Nase und erinnerte sie daran, dass sie vom Tod umgeben war.
Jochen Saalfelder war klein und dick und hatte eine Glatze, in der sich das Deckenlicht spiegelte, und die von einem Kranz aus starken, schwarzen Haaren gesäumt war. Der Kontrast war wegen seiner hellen Haut sehr stark. Die Haare standen senkrecht auf der Kopfhaut wie die Borsten eines Igels. Mit seiner runden Metallbrille und den leichten Hängebacken erinnerte er entfernt an Heinrich Himmler.
Читать дальше