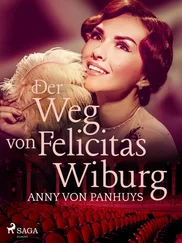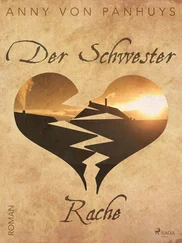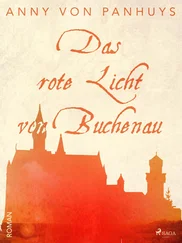Die Kleine hatte ein so frisches, unbefangenes Wesen, und ein feiner Hauch der Unberührtheit umgab sie, der ihm zu Kopf stieg wie der Duft edlen Weines.
Er streckte vorsichtig seine Rechte aus, an der ein grosser Wappenring auffiel, versuchte Maria Reinhards feines Händchen zu erfassen. Doch flink zog sie es zurück, lachte und fühlte doch das Blut in ihre Wangen steigen, das Herz lebhafter schlagen.
Er sagte leise: „Nun, bitte, Sie wundersüsses Blauäugelein, erzählen Sie mir, wer Sie eigentlich sind, wie Sie heissen, wo Sie wohnen?“ Es war immer gut, darüber Bescheid zu wissen, denn Ulrich hatte seinerzeit mit der Bemerkung nicht unrecht: Unsereiner aber soll gleich mit dem Trauring antreten, sonst heisst’s: Natürlich, wieder so’n Junker! — Er hatte gar keine Lust, durch eine unüberlegte Liebelei Heidelbergs Klatschzungen in Bewegung zu setzen.
Maria Reinhard dachte gar nicht daran, ihren Namen zu nennen, er konnte damit anfangen, sich vorzustellen. Ihr fiel die Rolle des „Rautendelein“ in der „Versunkenen Glocke“ ein, die Frau Marianne Dieter mit ihr durchgenommen. Lächelnd erwiderte sie:
„Woher ich stamme, wüsst’ ich nicht zu sagen,
noch auch, wohin ich geh’. Die Buschgrossmutter
hat mich von Moos und Flechten aufgelesen.“
Der schlanke Mann lächelte auch. „Also Rautendelein hab’ ich vor mir, das Fabelwesen, das in Schlesiens Bergen spukt.“ Er verneigte sich im Sitzen scherzhaft. „Darf ich gewöhnlicher sterblicher Mensch mich erkundigen, weshalb Rautendelein zurzeit hier weilt, so fern der Heimat?“
Das junge Mädchen amüsierte sich köstlich.
„Verwandte meiner Art hausen hier am Jettenbühl und Gaisberg, ich bin zum Besuch bei ihnen in einer Erdhöhle.“
Der Student wagte es abermals, die Rechte vorzuschieben. Dieses phantastische, kecke Mädchen machte ihm das Herz warm, ein Kuss von den rosigen, scharfgezeichneten Lippen, hinter denen schneeige Zähne in Reih und Glied standen, lockte ihn.
Schon umspannte er die kleine, weiche Hand, schon war sein Kopf dem braunen Mädchenkopf nahe, da sprang die Zierliche mit graziösem Sprung auf. „Rautendelein muss fort.“
Er eilte ihr nach, umfasste ihre schmalen, kinderzarten Schultern.
„Wann und wo darf ich Rautendelein wiedersehen?“
Sie wollte sich losmachen, doch seine nervigen Finger hielten sie fest. „Hören Sie, Rautendelein, ich glaube nicht an Ihr spukhaftes Elfenweibtum, Sie sind ein süsses Heidelberger Mädel.“
Sie lachte. „Und wenn ich das wäre?“
Er sah ihr tief in die Augen, ein Gedicht fiel ihm ein, er sprach es leicht betont, liess ihre Schultern dabei nicht frei:
„Wenn des blauen Himmels
helle Sternenpracht
sich im Neckar spiegelt:
Nimm dein Herz in acht,
süsses Mädel!
Wenn im Neckartale
mit dir scherzt und lacht
fröhlich ein Vandale:
Nimm dein Herz in acht,
süsses Mädel!
Wenn Studenten singen
durch die Vollmondnacht,
und die Gläser klingen:
Nimm dein Herz in acht,
süsses Mädel!
Doch es gilt das fromme:
‚Nimm dein Herz in acht!‘
nie, wenn ich mal komme.
Dann heisst’s: Aufgemacht,
süsses Mädel!“ a
Er neigte sich ganz nahe, und plötzlich ward der hübschen, blutjungen Maria Reinhard ganz eigen zumute. Wie eine wonnige Betäubung legte es sich über ihr Denken, und unfähig, sich zu rühren und Widerstand zu leisten, liess sie es geschehen, dass sich der schlanke Mann niederbeugte und ihre reinen Lippen küsste.
Ein seltsamer Schauer glitt über ihren Körper und ihr war es, als müsse sie sich fest an den hochgewachsenen Mann schmiegen und ihre Arme um seinen Hals schlingen.
Doch fast im selben Augenblick kam die Ernüchterung.
Ja, schämte sie sich denn nicht, sich von einem Studenten heimlich küssen zu lassen, von dem sie nichts, aber auch gar nichts wusste, dessen Name ihr unbekannt war, und der vielleicht allen Mädchen in Heidelberg nachlief?
Sie riss sich plötzlich von ihm los, schluchzte laut auf.
„Sie sind schlecht, o, so bodenlos schlecht, und ich verbiete Ihnen, jemals wieder in meine Nähe zu kommen!“
Ihre kleinen Füsse stampften zornig den Boden, und dann rannte Maria Reinhard wie gejagt davon.
Mit verdutztem Gesicht blieb der Mann zurück.
Er durfte der Wunderschönen nicht folgen, sie war zu erregt, und das Schloss war heute sehr besucht, wie stets an solchen Sommertagen. Er mochte nicht die Gefahr einer Szene vor dem Publikum heraufbeschwören, und die Kleine wäre dessen in ihrer Aufregung fähig gewesen.
Er hatte schon Glück gehabt, dass die Szene eben unbemerkt geblieben, aber dieser Erdenwinkel lag zu versteckt, dennoch hätte jeden Augenblick irgend jemand kommen können.
Er ging zu dem vorhin innegehabten Fensterplatz zurück, setzte sich und sann.
Wie eigentümlich das war! Erst hatte die Kleine ganz hingebend in seinen Armen geruht, und dann mit einem Male war sie gleich einer Wildkatze davon, nachdem sie ihn noch tüchtig angefaucht.
Er fühlte plötzlich ein Gefühl, das wie Sehnsucht war, ein ganz schweres, banges Gefühl, und ihm war es, als ruhten seine Lippen wieder auf dem jungen, jungen Munde und er spüre einen leisen, ganz leisen Gegendruck.
Noch niemals vor ihm hatten Männerlippen den Jungmädchenmund berührt, das wusste er in diesem Augenblick mit aller Bestimmtheit. —
Er blickte hinaus in den Sommertag, sass stille auf diesem abgelegenen Plätzchen und träumte wie ein junger Fuchs von seiner Liebe.
Fast noch eine Viertelstunde sass er so, dann klopfte er sich Sand- und Steinspuren vom Anzug und ging, er mochte sich jetzt nicht zu den Korpsbrüdern gesellen, mochte jetzt nicht den Kuss mit Bier oder Wein von seinen Lippen spülen.
Franz-Ferdinand, Graf von Wildhausen, hatte, seiner Neigung folgend, vor dem Kriege in Heidelberg Medizin studiert. Es hatte ziemlich schwere Kämpfe mit dem Vater gekostet, der nicht begreifen wollte, wie ein Mensch, der es nicht nötig hat, Interesse für die ärztliche Kunst haben konnte.
Seine Mutter begriff es schon eher. Vielleicht, weil sie den Sohn überhaupt von je besser verstand als ihr Gatte, der sich stets exklusiv allem Leben und Erleben fernhielt, das sich nicht auf den Höhen abspielte, auf die ihn seine Geburt verwies. Er führte den Fürstentitel, der jeweils auf den ersten Sohn überging. Als Franz-Ferdinand V., Fürst von Weyden, Graf von Wildhausen, Freiherr zu Bärstein, residierte er mit seinem zwanzigsten Jahr auf Schloss Wildhausen, empfing ab und zu allervornehmste Gäste, reiste von Zeit zu Zeit irgendwo auf einen feudalen Herrensitz zu Besuch, und es existierte für ihn nur, was ihm gefiel und sich mit seinen Standesanschauungen deckte. Dass es ganz nahe um ihn herum noch eine andere Welt gab, eine Welt der Künstler, Gelehrten, Bürger, Bauern und Arbeiter, bemerkte er kaum.
Auf Bitten seiner Frau gab er endlich nach, nannte eine Laune, was dem jungen Franz-Ferdinand bitterer Ernst war. Der menschliche Körper, dieses wundervollste Wunder der Schöpfung, diese zugleich komplizierteste und einfachste Maschine, reizte ihn gleich einem Rätsel. Er wollte ihre tiefsten und heiligsten Geheimnisse ergründen, damit er herausbringen konnte, wie so manche Krankheit zu heilen oder wenigstens zu lindern wäre, für die heute noch die rechten Mittel fehlten.
Zweiundeinhalbes Jahr hatte er bereits in Heidelberg studiert, da brach der grosse Völkerkrieg aus, und er zog hinaus wie alle die vielen Söhne der Heimat, um dann kurz vor Ausbruch der Revolution zurückzukehren. Er brachte seine geraden Glieder wieder heim, die mehrfach erlittenen Verletzungen hatten keine Spuren hinterlassen.
Dann kamen die Novembertage, die Fürstenthrone stürzten, und auch Franz-Ferdinand V. ward Privatmann, lebte das Leben eines Gutsherrn und musste sich daran gewöhnen, dass die höfische Etikette, auf die er sehr hielt, und die ihm Lebensbedingung geworden, sehr zusammenschrumpfte unter dem Hauch der neuen Zeit, der durch Türen und Fenster heranzog, selbst wenn er die Spalten aufs sorgfältigste verstopfte.
Читать дальше