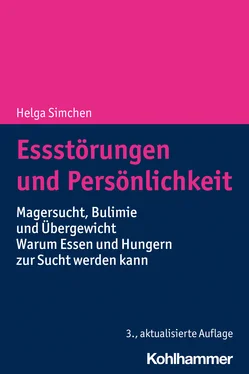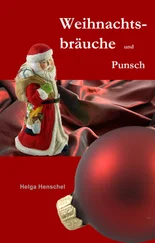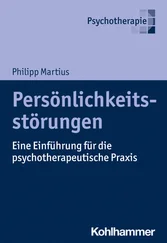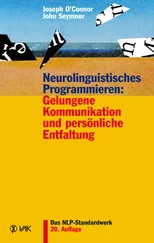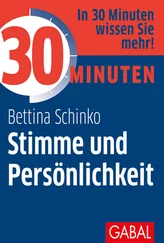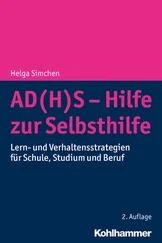Essstörungen entstehen vorwiegend in jenem zeitlich umschriebenen Lebensabschnitt, der entwicklungsbedingt sehr belastend ist. Belastend für diejenigen, die den pubertätsbedingten Anforderungen infolge ihres Reiferückstandes in der Persönlichkeitsentwicklung nicht gewachsen sind. Das bedeutet, dass wir Essstörungen als ein Ergebnis einer schon lange vor der Pubertät bestehenden, ständig zunehmenden psychischen Destabilisierung verstehen müssen.
Mädchen und Jungen in der Pubertät dienen Essstörungen dabei als ein scheinbar erfolgreiches Mittel, um die seit Jahren bestehenden quälenden Insuffizienzgefühle zu kompensieren und zu verdrängen. Dazu kommt eine ganz bestimmte Summe gemeinsamer Persönlichkeitsmerkmale, die das Entstehen einer Essstörung begünstigen und die in Zukunft mehr beachtet werden sollten. Eine große Bedeutung hat dabei zwanghaftes Verhalten, denn Zwänge sind »Hilfsmittel« zur Bewältigung psychischer Probleme.
Anlagebedingte Persönlichkeitsmerkmale, die in ihrer Summe für die Entwicklung von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen verantwortlich sind
• Hohe individuelle Ansprüche an die eigene Person, die zu einem dauerhaften und schmerzhaften Konflikt zwischen Wollen und Können beitragen, weil sie im Alltag trotz großer Anstrengungen immer wieder nur ungenügend realisiert werden können und deshalb zu Frustration führen
• Der Wunsch, in Bezug auf Aussehen und Erfolg für andere ein Vorbild zu sein und als solches respektiert und bewundert zu werden
• Eine starke Abhängigkeit von Rückmeldungen anderer Kinder bzw. Jugendlichen
• Eine (im Vergleich zu den Altersgenossen) überdurchschnittlich große seelische Empfindlichkeit
• Fehlende Stresstoleranz
• Mangelnde Fähigkeit zur Konzentration und Daueraufmerksamkeit mit der Tendenz zum Tagträumen
• Schwierigkeiten, schnell und angemessen reagieren zu können
• Niedriges Selbstwertgefühl, trotz meist sehr guter Intelligenz bis zur Hochbegabung
• Unvermögen, seine Interessen anderen gegenüber angepasst durchsetzen zu können
• Entwickeln von Gefühlen der Hilflosigkeit durch ständiges Misslingen geplanter Änderungsversuche
• Tendenzen zum Perfektionismus und zu zwanghaften Verhaltensweisen
• Großes soziales Harmoniebedürfnis mit stetem Gefühl, nicht verstanden zu werden
• Soziale Überangepasstheit mit Rückzugstendenz
• Ausbilden von Gefühlen sozialer Ausgrenzung und geringer sozialer Anerkennung
• Hohe Ansprüche an andere
Diese Persönlichkeitsmerkmale, die sich bei Kindern zumeist schon frühzeitig erkennen lassen, haben ihre Ursache in einer besonderen Art der Informationsverarbeitung, die eine altersentsprechende Hirnreifung verhindert. Infolge anlage- und erziehungsbedingter sowie geschlechtsspezifischer Einflüsse sind davon besonders Mädchen, weibliche Jugendliche und junge Frauen betroffen. Sie reagieren meist introvertiert, geben sich häufiger die Schuld, können sich nicht so schnell, redegewandt und sozial angepasst verteidigen, sie resignieren schneller und sind stressempfindlicher. Angehörige des männlichen Geschlechts reagieren dagegen zumeist aggressiver, sind durchsetzungsstärker und weisen in der Regel alle Schuld erst einmal von sich (Jean et al. 2007). Aber es gibt auch Jungen, die anders reagieren.
2.2.3 Die Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit
Männer und Frauen reagieren unterschiedlich (Spitzer 2003, Simchen 2008b)! Warum und wie die geschlechtsspezifische Verschiedenheit im Fühlen und Handeln zustande kommt, damit beschäftigt sich in der Wissenschaft die sog. Gender-Forschung. Sie untersucht die Rolle des Geschlechts als soziale Kategorie. Das weibliche und das männliche Gehirn unterscheiden sich anlagebedingt, was die körperliche und psychische Entwicklung prägt.
Das weibliche Gehirn ist entwicklungsgeschichtlich bedingt mit viel mehr vernetzenden Nervenbahnen für Gefühle ausgestattet (Spitzer 2002). Die Nervenbahnen der beiden Gehirnhälften sind stärker miteinander verbunden, sodass das Denken komplexer erfolgt und so dauert es auch länger, bis sich Stress und Erregung wieder normalisieren können. Vermittelt die Erziehung in der frühen Kindheit zu intensiv typische weibliche Verhaltensmuster, so kann sich eine sehr sensible, sozial angepasste und nach Harmonie strebende, rücksichtsvolle und somit »typisch weibliche« Persönlichkeit entwickeln. Zusätzlich kann die Mutter als enge soziale Bezugsperson, wenn sie denn auch über diese Eigenschaften verfügt und sie dem Mädchen vorlebt, diese unbewusst mittels Spiegelneuronen auf ihre Tochter zusätzlich übertragen.
Das männliche Gehirn unterliegt im Vergleich hierzu von Anfang an viel mehr dem Einfluss von Testosteron und es ist strategischer veranlagt. Es verfügt über viel weniger Kontakte zu den emotionalen Zentren. Jungen können damit in aller Regel – im Vergleich zu Mädchen – mit Emotionen rationaler umgehen, Stress und Erregung schneller abbauen. Das männliche Gehirn hat mehr sog. strategische Nervenbahnen, die beiden Hirnhälften sind weniger miteinander verknüpft. Jungen reagieren deshalb von Natur aus weniger nachhaltig auf Emotionen – ihren Ärger reagieren sie nach außen und deutlich schneller ab. Sie können gefasster, strategisch besser, nüchterner und distanzierter reagieren.
Es gibt aber auch Jungen, deren Gehirn viel empfindlicher reagiert – eher wie das eines Mädchens – und das spüren die Betroffenen auch. Diese Gruppe Jungen sind es, die unter ganz bestimmten Bedingungen in der Pubertät eine Essstörung entwickeln können.
Aus der Zwillingsforschung weiß man, dass ein Mädchen mit einem männlichen und somit zweieiigen Zwilling viel seltener an Magersucht erkrankt, als es bei einem weiblichen, also gleichgeschlechtlichen Zwilling geschieht. Das Testosteron, das der männliche Zwilling im Mutterleib bildet, gelangt über den Blutkreislauf in den Körper des weiblichen Zwillings, wo es dessen Gehirnentwicklung beeinflusst. Ein gleichgeschlechtlicher, weiblicher Zwilling beeinflusst durch seine Östrogenausschüttung in das Fruchtwasser das Gehirn seiner Schwester so, das sich in deren Gehirn das emotional wirksame serotonerge System verstärkt anlegt. Denn die von weiblichen Föten produzierten Sexualhormone (Östrogene) verbessern in der Anlage die Anzahl an Serotoninrezeptoren, sodass das Gehirn dann emotional anders reagiert, viel sensibler. Auch hierin liegt ein Grund, warum Frauen viel häufiger an Magersucht erkranken als Männer.
Aber zum Glück ist unser Gehirn veränderbar, plastisch, wie es die Wissenschaftler nennen: Äußere und innere Einflüsse verändern während des gesamten Lebens bewusst und unbewusst unser Verhalten und unsere Gehirnstrukturen, die sich den Anforderungen anpassen.
Die anlagebedingten und geschlechtstypischen Eigenschaften oder Vorurteile wie z. B.: »Frauen reden, Männer handeln« (Spitzer 2002), oder: »Mädchen verstehen nichts von Mathematik und Technik«, verlieren im Rahmen moderner Erziehung immer mehr an Richtigkeit. Die neurobiologische und psychologische Forschung hat jedoch bewiesen, dass die meisten Frauen auf die gleichen äußeren oder inneren Stressoren – im Vergleich zu Männern – empfindlicher und länger reagieren. Auch diese Reaktion ist dank der Plastizität des Gehirns veränderbar und somit anpassungsfähig. Solche Veränderungen im Verhalten gehen jedoch nicht von heute auf morgen, sie brauchen Zeit, in der sich die dazu nötigen Gedächtnisspuren ausbilden. Mädchen und weibliche Jugendliche sind anlagebedingt viel empfindlicher, was durch Erziehung, Umwelteinflüsse und selbst gemachte Erfahrungen noch verstärkt werden kann (Spitzer 2002).
Frauen haben ein empathisches Gehirn, Männer ein strategisches.
Читать дальше