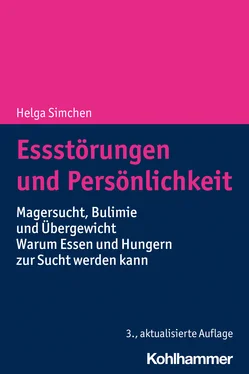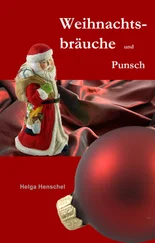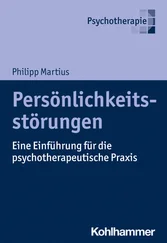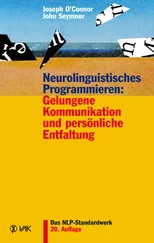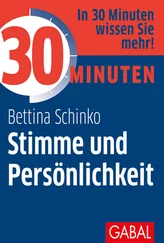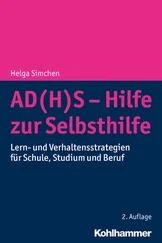Selbstunsichere Menschen sind sehr abhängig von externem Feedback. Auf der Suche nach Erfolg und Anerkennung suchen sie sich solche Vorbilder, denen nachzueifern im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt. In der jetzigen Zeit scheinen innere Werte und Leistungsbereitschaft unter dem Gros der Jugendlichen viel weniger Anerkennung zu finden als äußere Erscheinungsbilder. In der Schule werden gute Leistungen von den Mitschülern oft als Streberei bezeichnet und verspottet. Gerade selbstunsichere Jugendliche können die Hintergründe nicht durchschauen und möchten auf keinen Fall als Streber gelten. TV-Serien und Kinofilme zeigen den Jugendlichen, dass gut aussehende Menschen Erfolg haben, während die weniger gut aussehenden die Benachteiligten oder gar die »Bösen« sind und meist als schwache Charaktere erscheinen.
1.5.5 Die Mängel unseres Schulsystems
Zu den Faktoren, die eine Zunahme psychischer Störungen bei unseren Kindern begünstigen, zählen auch Veränderungen in Schule und Unterricht, die den Lernerfolg nicht weniger Schüler beeinträchtigen und bei diesen zusätzlich zu Stress und Misserfolgen führen. In vielen pädagogischen Bereichen, die wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ausüben, wird viel zu sehr auf wissenschaftlich unzureichend fundierter Basis experimentiert. Beispiele dafür sind:
• Kein frontaler Unterricht mit Blickkontakt zum Lehrer
• Das Schreiben in den ersten Klassen erfolgt nach Gehör und ohne Beachtung von Groß- und Kleinschreibung, Doppellauten und Vorsilben. Dadurch entwickeln sich bei vielen Kindern die neuronalen Bahnen, das Wortbildgedächtnis und die Automatisierung des Schreibvorganges zu spät oder nur unzureichend. Falsch geschriebene Wörter werden im Langzeitgedächtnis dann erst einmal abgespeichert.
• Das gleichzeitige Aufzeigen zu vieler unterschiedlicher Rechenwege
• Das Erlernen der Zeichensprache oder der alten deutschen Schrift
All diese methodisch nicht abgesicherten und die Schüler überfordernden Vorgehensweisen mussten Kinder über sich ergehen lassen, die in den letzten Jahren wegen Lernproblemen in meiner Praxis in Behandlung waren. Natürlich gingen ihre Lehrer davon aus, ihren Unterricht durch den Einsatz vielfältiger Methoden besonders gut und interessant zu gestalten. Manches sollte den Kindern das Lernen erleichtern – nur wurde bei einigen Schülern dadurch das Gegenteil erreicht.
Auch das ständige Umsetzen in den unteren Klassenstufen ist eine zusätzliche Belastung für viele Kinder. Die heutzutage in Klassenzimmern häufig anzutreffende Anordnung der Tische und Stühle in Sechsergruppen und kreisförmig im Raum kann kein Vorteil sein. Viele Kinder haben weder den Lehrer noch die Tafel im Blickfeld, wenn sie geradeaus schauen. Kinder brauchen in der Grundschule zum Lernen den Frontalunterricht und Ruhe in der Klasse. Ihr Augenkontakt zum Lehrer, seine Mimik und Gestik fixieren ihre Aufmerksamkeit auf das von ihm Gesprochene. Ein Kind, das in der ersten Klasse schon mit dem Rücken zur Tafel sitzt und sich ständig zur Lehrerin und zur Tafel umdrehen muss, ist in seiner Lernfähigkeit von Anfang an benachteiligt. Da hilft auch kein ständiger Platzwechsel.
Lernen setzt eine Kontinuität im Lernprozess mit einer guten Beziehung zum Lehrer und einem stabilen äußeren Rahmen voraus.
Die häufigen Vertretungsstunden aufgrund abwesender Lehrer, der Lehrermangel und die häufige Überforderung unserer Lehrer belasten die Schüler indirekt.
Die Ganztagsschule, die richtig ausgeformt grundsätzlich zu begrüßen ist, weist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch einige Mängel auf. Sensible, reizüberforderte Kinder leiden unter der Lärmbelastung, der sie den ganzen Tag ohne Unterbrechung ausgesetzt sind. Sie können sich in den Zwischenzeiten nicht ausreichend erholen, um Kräfte zu sammeln und Stress abzubauen. Schriftliche und mündliche Schularbeiten sollten erledigt sein, wenn Schüler gegen 16 Uhr die Schule verlassen. Wenn Kinder in der Unterstufe nach 17 Uhr noch ausstehende Hausaufgaben zu Hause erledigen müssen, sind sie damit überfordert und reagieren mit Ablehnung oder Verweigerung.
Der häufig überfüllte Pausenhof stellt für einen Teil der Kinder mit seinem zu hohen Geräuschpegel ein weiteres belastendes Problem dar. Auf dem Schulhof größerer Schulen verbringen nicht selten über 1.000 Kinder ihre Pause. Hier kann nicht abgeschaltet werden, die Geräuschkulisse verstärkt stattdessen vorhandenen Stress. Für vorgesehene körperliche Beschäftigungen reichen die bereitstehenden Spiel- und Sportgeräte oft nicht aus. Die Enge des Pausenhofs erhöht die Aggressivität, da viele Kinder bewusst oder unbewusst angerannt werden und sich provoziert fühlen. Vorhandene Aggressivität wird durch das Provozieren von Mitschülern abreagiert. Der Aufsicht habende Lehrer ist dabei von vornherein überfordert.
Entwicklungsbeeinträchtigungen nehmen in der Kindheit infolge nicht verkraftbarer psychischer Dauerbelastungen und dem damit verbundenen Stress zu.
Was könnte das Schulsystem dagegen tun? Für eine positive Persönlichkeitsentwicklung aller Schüler sind qualitativ gut ausgebildete und als Vorbild für die Schüler dienende Lehrer, die nach einem wissenschaftlich fundierten Lehrprogramm kontinuierlich arbeiten, leider noch zu häufig ein Wunschtraum. Ruhe, Kontinuität und Rituale im Unterrichtsablauf wären erforderlich. Auch eine regelmäßige Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Elternhaus wären förderlich bzw. notwendig.
Warum die Schule für manche Kinder zum »Stressfaktor Nr. 1« wird
Ein häufiger Platzwechsel im Klassenzimmer, die Abschaffung des Frontalunterrichtes, die vielen Freiarbeitsstunden schon in den unteren Klassen, ineffektive, die Kinder überfordernde Methoden des Schreiben- und Rechnenlernens, die vielen Vertretungsstunden und die ständige Unruhe in der Klasse und auf dem Pausenhof sind eine große psychische Belastung, der viele Kinder auf Dauer nicht gewachsen sind. Hinzu kommen die verordnete Nachhilfe, die einige Schüler zwei- bis dreimal pro Woche haben, sowie der Förderunterricht in der Schule, manchmal sogar auf Kosten der Sportstunde, die gerade die psychisch labilen Kinder so dringend benötigen.
Um es klarzustellen: Schulische Stressfaktoren sind keine direkten Auslöser einer Essstörung, sie belasten aber die Schüler und begünstigen bei einigen von ihnen die Zunahme und Schwere psychisch und psychosomatisch bedingter Erkrankungen, von denen eine die Essstörung sein kann. Denn anhaltender negativer Stress wird auch schon von Kindern und Jugendlichen mit Appetitlosigkeit oder Frustessen abreagiert. Zu diesen schulischen Faktoren kommen noch sehr viele aus dem familiären Bereich und dem sozialen Umfeld, die aber weitgehend bekannt sind. Die für die Entwicklung einer Essstörung wichtigen Faktoren werden im Folgenden in den entsprechenden Kapiteln dieses Buches beschrieben.
1.6 Die Bedeutung der Forschung
Medizinische Wissenschaftler (Braus 2004, Kaye 2008, Bulik et al. 2007, Krause und Krause 2009) suchen nach genetischen und molekularbiologischen Ursachen, um die Auswirkungen der angeborenen veränderten Informationsverarbeitung in einen Zusammenhang mit der Entwicklung psychischer Störungen zu bringen. Essstörung als Ausdruck einer angeborenen veränderten Art der Reizverarbeitung anzusehen, würde diese Ursachenforschung beleben und helfen, viele Details ihres Verlaufs zu erklären. Im Interesse der Betroffenen und den Erfahrungen aus der Praxis folgend sollte die psychiatrische Forschung die Neurologie, die Entwicklungspsychologie und die Verhaltensforschung mit einbeziehen. Auch in der Psychiatrie haben Studien zu Krankheitsverläufen, die Erfahrungen aus der Praxis sowie die Erkenntnisse durch die bildgebenden Verfahren in der Neurobiologie und der Genetik für die Forschung eine wegweisende Bedeutung. Eine fachgebietsübergreifende Forschung ermöglicht die Trennung von mancher ausgedienten »klassischen« Lehrmeinung.
Читать дальше