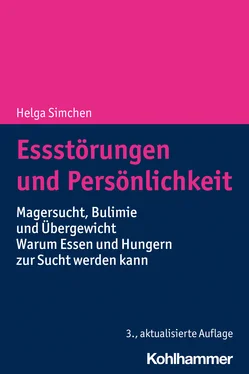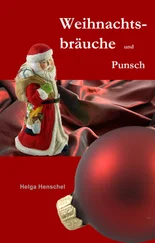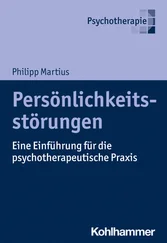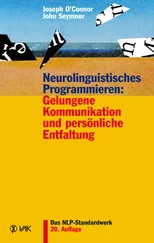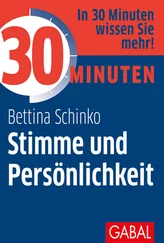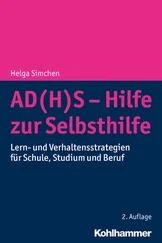Menschen mit ausgeprägten Essstörungen haben in ihrer Entwicklung und Persönlichkeitsstruktur viele Gemeinsamkeiten. Das kann kein Zufall sein! Die neuesten Ergebnisse der bildgebenden Hirnforschung (Braus 2004, Spitzer 2002) liefern Erklärungen für diese Gemeinsamkeiten, die unter ganz bestimmten Voraussetzungen die Ausbildung einer Essstörung begünstigen können.
Als unbekannte Größe für die Entstehung von Essstörungen wurde bisher immer wieder eine genetisch bedingte Persönlichkeitsvariante benannt, die man sich aber nicht erklären konnte. Wichtig ist es, frühzeitig nach entsprechenden Symptomen dieser Persönlichkeitsvariante, die zur AD(H)S-bedingten Spektrumsstörung gehört, zu suchen. Dadurch wird ein rechtzeitiges Eingreifen in deren Psychodynamik möglich, schon lange bevor die Betroffenen sich mit ihrer Problematik allein gelassen fühlen und zur »Selbsthilfe« greifen. Denn Magersucht und Bulimie, teilweise auch Adipositas, sind nur der Gipfel eines Eisbergs, dessen Entstehung eine über viele Jahre bestehende andere Art der Informationsverarbeitung vorausgeht. Diese wird durch die Überangepasstheit der Betroffenen und deren Bemühen, nur nicht negativ aufzufallen, lange kompensiert. Deshalb werden für eine möglichst frühzeitige Diagnose in erster Linie Kinderärzte, Eltern, Lehrer, Ergotherapeuten sowie Kindergärtnerinnen und Freunde der Betroffenen benötigt, die oft als Erste länger bestehende Auffälligkeiten im Verhalten der Betroffenen bemerken.
Schon lange, bevor es zu einer Essstörung mit suchtartigen Charakter kommt, läuft ein psychodynamischer Prozess ab, der erkannt und unterbrochen werden muss. Hierfür erforderlich sind jedoch Kenntnisse und ein genaues Beachten von Besonderheiten im Entwicklungsverlauf der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Ein solcher vorbeugender Ansatz ermöglicht eine frühzeitige Intervention und Behandlung zur Vermeidung von Essstörungen als Spätfolge einer langen Leidensgeschichte, die so von der Umwelt bisher nicht wahrgenommen wird.
Aufgrund der großen körperlichen und seelischen Nöte, unter denen die betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Essstörungen leiden, und wegen der mit ihnen verbundenen hohen Sterblichkeitsrate, die bei einer ausgeprägten Anorexie (Pubertätsmagersucht) etwa 23 % beträgt, besteht dringender Handlungsbedarf. Jeder Therapeut weiß, dass eine über längere Zeit bestehende Anorexie sich kaum mehr erfolgreich behandeln lässt. Infolge der anhaltenden Unterernährung kommt es zu bedrohlichen körperlichen und psychischen Schäden. Nerven- und Köperzellen leiden, ein rationales Denken ist nicht mehr möglich und wird durch irrationale Zwänge mit verzerrter Wahrnehmung ersetzt. Das anfängliche Vorhaben, an Gewicht abzunehmen und kalorienbewusst zu essen, wird zur zwanghaften Sucht, die Denken und Handeln bestimmt.
Veranlagung und Umwelt, innere und äußere Faktoren, Persönlichkeit und Belastbarkeit prägen im Wesentlichen die Entwicklung eines jeden Menschen. Das soziale Umfeld, die Umgangs- und Kommunikationsformen, das Schulsystem und die Freizeitbeschäftigung haben sich in den letzten Jahrzehnten so schnell und zum Teil grundlegend verändert, dass für viele die Anpassung an die neuen Strukturen und Lebensverhältnisse zum Problem wurde. Besonders bei Menschen mit anlagebedingten Besonderheiten in der Informationsverarbeitung können diese neuen Bedingungen psychische und physische Überforderungen auslösen. Bleibt die Überforderung aus, können sie von ihren besonderen Eigenschaften durchaus profitieren. Deshalb ist es für Kinder und Jugendliche, die sich noch in der Entwicklung befinden, wichtig, die dafür notwendigen optimalen Bedingungen zu kennen und zu schaffen, um deren seelische und körperliche Überforderung weitgehend zu vermeiden.
1.5 Warum psychische Störungen in der Kindheit zunehmen
Es gibt viele Gründe und Erklärungen dafür, weshalb seelische Störungen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren zugenommen haben. Die wichtigsten seien im Folgenden genannt.
1.5.1 Die zunehmende Reizüberflutung im Alltag unserer Kinder und Jugendlichen
Eine Vielzahl von Medien bildet heute im Alltag der Familien eine beständige Geräuschkulisse, die regelmäßige bzw. intensive Kommunikation beeinträchtigt und teilweise ersetzt. Kinder und Jugendliche tauschen ihre Gedanken und Gefühle zunehmend über die Medien oder das Handy aus.
Ständiges Fernsehen und stundenlanges Computerspielen überlasten das Arbeitsgedächtnis und verdrängen eben Gelerntes, sodass es nicht ins Langzeitgedächtnis weitergeleitet werden kann. Lernprozesse werden unterbrochen, Wichtiges kann unwiederbringlich verloren gehen. Die massive Reizüberflutung überlastet das Arbeitsgedächtnis und ein sowieso schon reizüberflutetes Gehirn reagiert mit Stress. Die Aufnahmekapazität des Gehirns sinkt, es ermüdet schneller, die Betroffenen arbeiten oberflächlich und unkonzentriert. Neurobiologisch gesehen kann ein ständig mit vielen optischen und akustischen Reizen überflutetes Gehirn keine »dicken Lernbahnen« zur schnellen Weiterleitung von Informationen vom Arbeitsgedächtnis zum Langzeitgedächtnis ausbilden, sodass die Automatisierung von Lern- und Handlungsstrategien und deren sofortiges Abrufen erschwert werden (Spitzer 2002).
Unkontrolliertes Fernsehen, Computerspielen und Chatten im Internet sind Lernkiller und werden so zu Stressfaktoren erster Ordnung. Sie werden von Kindern und Jugendlichen zwar als Entspannung empfunden, belasten jedoch tatsächlich das Gehirn und verdrängen das Gelernte aus dem Arbeitsgedächtnis, noch bevor dieses im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden kann.
Die häufig anzutreffende Reizüberflutung durch die Medien beeinträchtigt die Lernfähigkeit und das Sozialverhalten.
1.5.2 Der Mangel an sozialer Intelligenz und Kompetenz
Unter sozialer Intelligenz versteht man dabei die Fähigkeit, in Beziehungen klug zu handeln, d. h. ein Gefühl von Empathie, soziale Intuition und Impulse zum tätigen Mitgefühl entwickeln zu können (Goleman 1997).
Die soziale Kompetenz ist eine Fähigkeit, die sich nur durch persönliche Kontakte und Erfahrungen entwickeln kann. Sie schafft eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir unser Verhalten sozial angepasst ausrichten, unsere Umgebung emotional richtig erfassen und uns spontan in die Gefühle der anderen hineinversetzen können. Zur sozialen Intelligenz gehört auch die kognitive Fähigkeit, die Körpersprache der anderen zu verstehen, um unser Handeln dementsprechend auszurichten. Sie setzt eine gute Eigenwahrnehmung voraus, die wiederum durch eigene Erfahrungen und Beobachtungen erworben wird. Je mehr und je früher jedoch Medien zum wichtigsten und bevorzugten Kommunikationsmittel werden, umso weniger Selbsterfahrungen erwerben Kinder und Jugendliche für die Ausbildung einer emotionalen und sozialen Intelligenz. Auch bei vorhandener angeborener Störung in der Informationsverarbeitung leidet zuerst die soziale Intelligenz und mit ihr die soziale Kompetenz.
1.5.3 Der Verlust stabiler sozialer Strukturen
Die sich immer mehr auflösenden festen Strukturen in der Gesellschaft, in der Familie, in der Erziehung und im Schulunterricht sind nur einige Faktoren, die in ihrer Summe eine psychische Überforderung von Kindern und Jugendlichen begünstigen. Dazu gehören auch die unzureichende Vermittlung von sozialer Geborgenheit, Wertschätzung, Anerkennung und die gesellschaftlich bedingte zunehmende Unsicherheit der eigenen persönlichen und beruflichen Perspektive. Eine große Anzahl von Facebook-Freunden ist kein Ersatz für echte Beziehungen zu Mitmenschen. Nur diese können soziale Fähigkeiten vermitteln.
1.5.4 Die Anziehungskraft vermeintlicher Vorbilder
Читать дальше