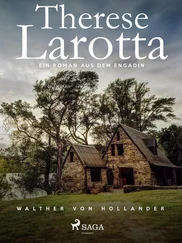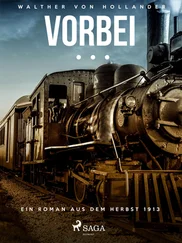Den Rest des Abends saß Frank bei seiner Mutter. Sie spielte ihm ein bißchen Mozart vor, so wie sie es früher immer getan hatte, und Frank saß auf der Erde neben ihr und hatte seinen Kopf an ihr Knie gelehnt. Da spürte man die Musik am stärksten, und wenn gar das Pedal getreten wurde, dann wurde hier unten das Brausen und Summen herrlich und schwindelerregend. Die Töne blieben beieinander und schwangen so stark, daß man selbst mit ins Schwingen kam.
Als die Mutter zu spielen aufhörte, sagte er: „Früher klang die Musik anders. Es waren wohl dieselben Noten. Aber wahrscheinlich bist du anders geworden.“
Renate Zylvercamp nickte. „Ein bißchen anders“, sagte sie, „natürlich.“
Der Junge stand auf, umarmte sie heftig und fragte: „Wann wirst du denn wieder anders? So wie früher?“
Renate sagte: „Man ändert sich nun mal ein bißchen, wenn man älter wird. Du bist ja auch nicht mehr so, wie du mit fünf Jahren warst.“
Frank gab sich damit nicht zufrieden. Er wußte aber nicht, wie er das ausdrücken sollte, was zu sagen ihm so wichtig schien.
„Du hättest dich nicht geändert“, sagte er, „es liegt doch nicht an dir ...“
Und jetzt sah er seine Mutter wieder an mit dem schneidenden Blick, der sie schon manchmal erschreckt hatte. Einem Blick voll Haß gegen ... ja gegen die ganze Welt.
Im vorigen Jahr hatte er in einer solchen Stunde geschrien, warum er denn nicht wie andere Jungen zu Hause sein könne. Renate hatte es ihm erklärt, so gut es ging. Der Vater war eben ganz anders als andere Menschen. Stärker und empfindlicher durch sein Schaffen. Es würde für Frank nicht gut sein, in dieser unruhigen Luft zu leben. Aber Frank hatte geantwortet: „Er könnte nun auch mal ruhig werden ...“
Renate blieb nichts übrig, als das Gespräch abzubrechen. Und auch dieses Mal lenkte sie einfach ab. So tief, meinte sie, würde es bei dem Jungen auch nicht sitzen.
Sie sprachen dann noch sehr vergnügt bis in die tiefe Nacht hinein von Ohrau, von dem großen Sessel am Kamin, über dem der ewige Holzbrand schwelte, vom Torfmoor, vom Nesselgrund gleich hinter dem Haus, vom Obstgarten, vom Pilzesuchen, von den Kusinen und von der Großmutter.
Gegen Mittag bekam Maria von Nemesch ein Telegramm von Wrede. Er könne frühestens in drei, vier Tagen kommen. Er werde sie aber gegen Abend anrufen. Gleichzeitig kam ein Brief von Zylvercamp. Er müsse sie unbedingt sprechen. Sie müsse Zeit für ihn finden, am besten einen ganzen Nachmittag oder Abend. Er würde sie gleich am Morgen anrufen.
Maria telegrafierte an Wrede, er solle sie bei ihrer Schwester Ilse anrufen. Sie packte einen kleinen Handkoffer wie zu einer Reise, mit Zeichenstiften, einem Kleid, Nachtsachen. Sie wollte auf keinen Fall zu Hause sein. Sie wollte nicht, daß Zylvercamp sie erreichte, ehe sie mit Wrede gesprochen hatte. Vielleicht, wenn sie sich endgültig band, würde sie gegen Zylvercamp und gegen sich selbst geschützt sein.
Gerade als sie den Koffer geschlossen hatte, läutete das Telefon. Maria schrak zusammen, zog hastig den Mantel an und schlug die Wohnungstür hinter sich zu. Sie stand noch eine ganze Weile im Garten zwischen den Dahlien, die in einer ungeheuren Pracht und Fülle aufgeblüht waren, unter einem Apfelbaum, der prunkend mit gelben Äpfeln besteckt war, in einer Sonne, die blendend vom Himmel und widerblendend vom See schien, und hörte minutenlang ihr Telefon läuten. Sie ging langsam durch den Garten nach dem Bahnhof zu. Sie war tief beschämt und sehr unentschlossen. Als sie bei Ilse, ihrer Schwester, ankam, hörte sie, daß Zylvercamp schon dreimal angeläutet hatte.
Sie nahm die beiden Kleinen, Gebhard, den Vierjährigen, und die zweijährige Sabine, nahm den Kinderwagen, zwei Affen, eine Puppe, einen Kreisel, einen Helm und ging mit allen diesen Sachen und den Kindern hinüber in den Zoo.
Sie unterhielt sich mit ihnen sehr gut vor den Käfigen. Die Hirsche röhrten ungeduldig hinter ihren Gittern, und ein gewaltiger Zwölfender jagte böse schreiend immer wieder hinter seiner Hirschkuh her und verfing sich dabei, mit seinem majestätischen Geweih, klappernd in den Gitterstangen.
Maria blieb mit den Kindern im Zoo, bis die Dämmerung kühl den ganzen Garten ausfüllte und die kleine Sabine vor Müdigkeit zu weinen anfing.
Als die Kinder schlafen gegangen waren, fiel Ilse Richter, die Regierungsrätin, der Schwester weinend um den Hals. Sie könne es nicht mehr aushalten. Sie müsse einmal sprechen. Aber sie sprach nicht, sondern lag der Schwester schluchzend wie ein kleines Kind an der Brust.
„Die Großmutter hat es immer gesagt“, stammelte sie.
Die alte Generalin Schüler war, nachdem sie anfänglich die Verbindung gefördert hatte, wirklich gegen diese Ehe gewesen. Sie fand den Regierungsrat ungeheuer flach und langweilig. Ilse war viel zu schade für einen Mann, der im Grunde ja doch nur für sich selbst lebte (obwohl, wie die Generalin sagte, die meisten Männer das tun, aber einige tun es wenigstens mit Grazie, mit Charme, oder ihr Leben hat einen Zweck). Viel zu schade war Ilse, um einem solchen Mann den Haushalt und die Kinder in Ordnung zu halten und auf Gesellschaften so hübsch auszusehen und so harmlos zu schwatzen, daß die Kollegen und die Vorgesetzten ihn um seine reizende Frau beneideten.
„Die Großmutter hat es immer gesagt.“ Weiter war aus Ilse nichts herauszukriegen. Aber Maria kannte ja auch die ungeheure Einförmigkeit ihres Lebens, die schneidigen, alles Lebendige beschneidenden Meinungen des Regierungsrats, die unsinnige Ordnungsliebe, mit der er seine Umgebung plagte (er organisierte den Haushalt wie einen Staat), seine Rechthaberei, seine fertigen Meinungen, denen sich alles im Leben zu fügen hatte.
Der unmittelbare Anlaß des letzten heftigen Streites war also einerlei. Maria hatte den Regierungsrat ein einziges Mal streiten sehen, käseweiß, leuchtend vor Hohn, bissig wie ein Köter, mit kränkenden Worten auf Ilse einflüsternd. Er nannte es „Haltung bewahren“, daß er nicht schrie.
Man brauchte sich also nicht über Einzelheiten zu unterhalten. Sie, Maria, wäre längst weggegangen. Aber Ilse wollte sich nicht scheiden lassen. Sie hing an ihren Kindern. Der Mann war ihr treu, wie man das nennt. Daß er sie beleidigte, war kein Scheidungsgrund. Sie mußte es also aushalten. Die einzige Hilfe war, daß sie manchmal weinen konnte.
Gegen neun kam der Regierungsrat. Ilse hatte sich längst gefaßt. Sie war nett angezogen. Der Tisch war hübsch gedeckt. Die Speisen waren ein bißchen zu zierlich, aber reizend angerichtet. Der Regierungsrat war verhältnismäßig gnädig. Er hatte einen guten Tag im Amt gehabt mit einer huldvollen Anrede durch den Staatssekretär. Er erzählte, daß man seine Arbeit — er arbeitete im Wasserbauamt — allmählich anzuerkennen beginne und die Notwendigkeit der Flußregulierungen, die er erfunden zu haben schien, auch in der breiten Öffentlichkeit einsehe.
Während sie noch beim Essen waren, meldete das Mädchen den Anruf von Zylvercamp, der dringend Fräulein von Nemesch zu sprechen wünschte.
Maria ging hinaus. Der Regierungsrat warf erregt die Serviette auf den Tisch und stand auf. Ob es nicht durchzusetzen sei, daß er einmal in seinen vier Wänden ungestört essen könne? Ob ihm Ilse nicht angedeutet habe, daß Maria so gut wie verlobt sei und ob sie es richtig finde, daß eine verlobte junge Dame mitten in der Nacht von ihrem Lehrer, einem recht seltsamen Lehrer anscheinend, angerufen werde?
Maria stand am Telefon im Gang. Zylvercamp in seinem Schlafzimmer. Er sprach — wie immer, wenn er erregt war — ziemlich hoch. „Ich habe jetzt zwei, nein drei Tage nachgedacht. Ich weiß es jetzt genau, daß ich Sie zum Leben brauche.“
Читать дальше