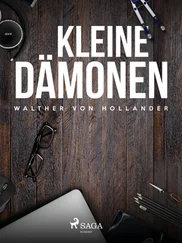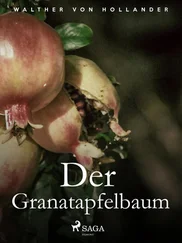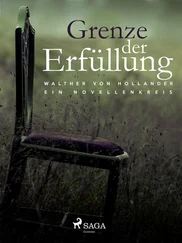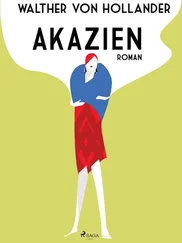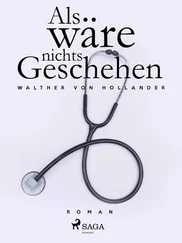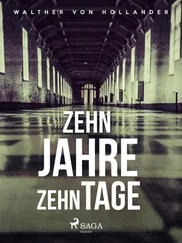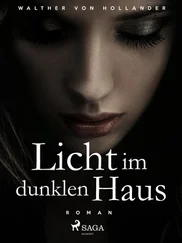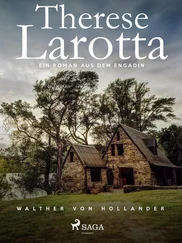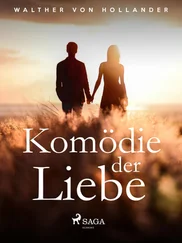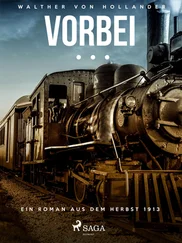Zylvercamp zeigte mit dem Stiel seiner Pfeife auf das Bild. „Gut“, murrte er, „ausgezeichnet“.
Renate nickte. „Ganz famos“, sagte sie, „aber du schonst dich wahrhaftig nicht.“
Zylvercamp sah überrascht auf. „Schonen“, fragte er, „warum soll ich mich schonen?“
Renate antwortete so vorsichtig, wie es sich für die Frau eines Künstlers geziemt: „Man könnte dich auch anders sehen.“
Der Maler hörte nur die Einschränkung in der Einwendung heraus. „Wenn man mich auch anders sehen könnte“, sagte er sehr scharf, „dann ist das Bild schlecht. Ein zufälliges Bild. Nichts Endgültiges.“
Renate mußte lachen. Sie packte ihren Mann bei seinem Haarkranz und beutelte ihn. „Früher hättest du mich mit so einem Unsinn erschreckt“, sagte sie (aber in Wirklichkeit war sie erschrocken), „jetzt weiß ich schon genau, was ich sage. Das, was du malst, ist das genaue, das tadellos getroffene, das intuitiv erschaute Selbstporträt. Du, wie du dich siehst. Damit also hast du recht.“
Zylvercamp hatte wieder seine Augen auf die Oberlichtfenster gerichtet. Er sah gespannt zu, wie die Gewittertropfen sich vermehrten, wie sie langsam in Regenbäche übergingen, die das Glas gelblich überspülten. Es tat ihm leid, daß der Sommerstaub weggewaschen wurde, als ob mit ihm auch das Schöne dieses Sommers wegfloß, das Flirrende des Sonnenscheins, die Hitze, unter der man nackt im Atelier herumspaziert war und „Lichtbilder“, tolle Blumenbilder, famose Menschenbilder „verfertigt“ hatte.
„Worin habe ich nicht recht“, fragte er langsam, „was habe ich nicht getroffen?“
„Das, was du noch nicht weißt“, lächelte Renate, „das, was hinter der Wirklichkeit sitzt, den inneren Kern hast du noch nicht mitgemalt, von dem du mir einmal erzählt hast. Das Kommende.“
„Das Kommende weiß niemand“, sagte Zylvercamp trotzig. Er hatte immer noch die Augen zum Oberlicht gehoben.
Renate aber zog ihn jetzt bei den Ohren herunter. Sie verlangte, daß er sie endlich einmal ansah. Seit ein paar Wochen, nein, seit Monaten, hatte er um sie herumgesehen, hatte er mit ihr gesprochen wie Odysseus mit den Schatten der Unterwelt. Nun erbat sie sich ein wenig Blut von ihm, um zu seinem Leben emporzusteigen, um einen Augenblick wie ein Mensch in der Sonne zu leben.
„Was du mir da sagst, ist mir wieder viel zu geheimnisvoll“, wehrte sich Zylvercamp. „Ich bin ein einfacher Maler, ein Mensch, der die Dinge sehen soll, wie sie sind. Kommt mit den Dingen auch ihr Hintergrund, ihr Untergrund, ihr Wurzelwerk auf die Leinwand, so ist das ein Geschenk, eine göttliche Gnade. Etwas, das man weder vom Schicksal noch von sich verlangen kann.“
Renate seufzte. Hier begann also wieder einmal das endlose Gespräch ihrer Ehe über die Wirklichkeit, über die Übersinnlichkeit und Sinnlichkeit, über den Sinn der Kunst, über das Geheimnis der Wirkung von ewigen Kunstwerken, ein vielgestaltiges Gespräch, jahrelang in tausend Stunden begonnen und über tausend immer wieder aufklaffende, immer wieder überbrückte Abgründe geführt, ein Gespräch, in dem jeder seine Feigheit und seine Tapferkeit hatte, seine Winkel, die er nicht gerne betrat, seine Steckenpferde, die er gerne ritt und die plötzlich scheuten und dem andern in die Parade ritten.
Aber jetzt in diesem Augenblick hatte sie wieder Anschluß gewonnen, hatte sie mit der Angel ihrer Rede ihn aus dem See der Trübsal herausgeholt, hatte er angebissen, und sie hielt ihn.
„Du sollst die göttliche Gnade nicht geschenkt nehmen“, sagte sie, „denn sie ist schon in dir. Du sollst nur in Wirklichkeit umsetzen, was schon in dir wirkt. Warum willst du nur malen, was du siehst, und nicht das dazu, was schon in dir brodelt, den Geist also, das, was hinter dem Fleisch unsichtbar wirkt?“
„Weil man das nicht kann“, sagte Zylvercamp hart.
Renate aber antwortete: „Dann wirst du es eben können machen. Wenn es bisher niemand fertiggebracht hat, dann mache du es doch als erster. Glaube mir, es ist bitter nötig.“
„Was ist also bitter nötig?“ fragte Zylvercamp, immer noch ein wenig widerwillig.
Renate sagte unerschrocken: „Es ist bitter nötig, das Neue zu malen, das schon in dir steckt. Das zu gestalten, wogegen du dich wehrst.“
„Ich wehre mich nicht“, sagte Zylvercamp, „denn ich spüre nichts, wogegen ich mich wehren sollte. Ich spüre nur das, was ich gemalt habe, und nichts mehr. Gar nichts mehr. Alles andere ist nicht da.“
„Es ist aber da“, sagte Renate beschwörend, „deshalb mußt du es malen. Du sagst in deinem Bilde sehr viel. Aber du verschweigst beinahe mehr.“
Und als ob der Himmel ihre Worte bestätigen wollte, riß ein Blitz hinten über den Tiergartenbäumen die Wolken auf, und eine gewaltige Bö wischte über die Scheiben, daß es trommelte wie von tausend fernen Trommeln. Sie schwiegen beide. Für einen kurzen Augenblick waren sie wieder ganz beisammen. Eingehüllt in die große Regenhaube, saßen sie von aller Welt getrennt. Eingehüllt in die gleichen Gedanken, waren sie vereint.
Abends holte Renate ihren Sohn ab, der Herbstferien bekommen hatte. Frank war gerade dreizehn geworden. Er ähnelte Zylvercamp in der Kinnpartie. Von seiner Mutter aber hatte er die Stirn, die für einen Jungen merkwürdig hoch und weiß war. Die Augen, sehr große, braune Augen, die fragend und schneidend waren, hatte er von keinem von beiden.
Er war überhaupt aus einem Stoff gemacht, der seinen Eltern nicht leicht verständlich war. Deshalb hatten sie ihn wohl auch in einem Landerziehungsheim untergebracht. Deshalb und weil sie viel reisten. Weil sie bald in Berlin und bald in ihrem Häuschen im Fextal, oberhalb des Engadins, lebten, und glaubten, es müsse so sein.
Frank war nur an diesem einen Abend da. Am anderen Tag sollte er zur Großmutter fahren, zu Zylvercamps Mutter, die auf ihrem Altenteil in Westfalen saß. Er fuhr in jedem Herbst hin, erntete die Obstbäume ab, die in Großmutters Gartenstück standen, half dem Onkel Paul, Zylvercamps Bruder, ein wenig beim Pflügen und trieb sich mit den beiden Kusinen im Walde umher, um Pilze und Beeren zu sammeln, Kienäpfel und Bruchholz für die Großmutter. Es war die schönste Zeit des Jahres für ihn, und er sprach fast den ganzen Abend von Ohrau und der Großmutter.
Zylvercamp ging mit Frank eine Stunde in Berlin bummeln. Sie saßen in der Konditorei am Kurfürstendamm, in der er mit Baudis am ersten Oktober verabredet gewesen war. Frank aß vier Mohrenköpfe und zwei Portionen Eis. Er sprach von einem Lehrer, der „großartig“ laufen könne, „aber auch sonst sehr klug sei“. Er sprach von einem Wettkampf, in dem er der Dritte geworden war. Er fand Berlin „ulkig“ und eigentlich langweilig. Man könne hier im Café gar nicht glauben, daß die vielen Leute auch einmal arbeiteten. Sicherlich gingen sie immer auf der Straße auf und ab oder saßen vor leeren Tassen und Tellern und lasen Zeitungen.
Zylvercamp fragte ihn, ob es dabei bleiben würde, daß er einen Bauernhof in Westfalen, gleich neben dem Altenteil der Großmutter, haben wollte. Frank sah ihn erstaunt an. Er sagte: „Aber das ist doch selbstverständlich! Das geht doch gar nicht anders.“
„Das geht gar nicht anders?“ Zylvercamp mußte lachen. Genau so war er mit dreizehn Jahren gewesen. Was er haben mußte, das bekam er auch, weil es gar nicht anders ging.
Er marschierte mit dem Jungen Arm in Arm nach Hause. Er dachte, als sie zusammen durch den dunklen Tiergarten gingen, der noch feucht war vom Gewitterguß, glitschig ein wenig, herbstneblig unter den Büschen, er dachte, wie spät er doch zu allen Dingen im Leben kam (außer zum Erfolg, der war sehr früh gekommen). Andere Männer waren in seinem Alter Großväter. Er wuchs erst ganz allmählich in die Rolle des Vaters hinein. Jetzt erst begann er seinen Jungen Frank richtig von Herzen zu lieben. Das war schon ein großer Fortschritt. Denn Kurt Zylvercamp, den Sohn aus erster Ehe, der jetzt in München ein feiner junger Herr war, ein Assessor und ein Bergsteiger, sehr rechtlich und auf sein Recht aus, den hatte er nie lieben können. Aber diesen Frank an seiner Seite, mit den fremden, messerscharfen Augen, den liebte er nun.
Читать дальше