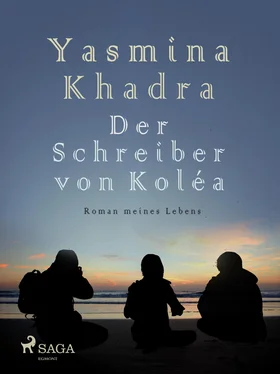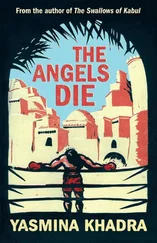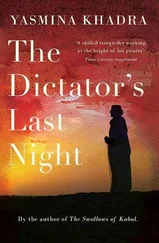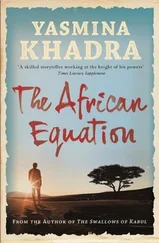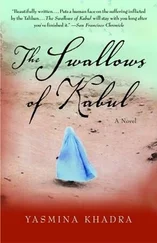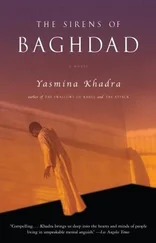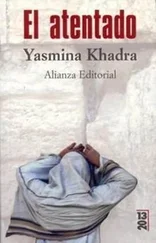»Er kommt mit uns mit«, erklärte mein Vater. »Er ist einer von den Kriegswaisen. Die Direktion hat mich darum gebeten, und ich habe zugestimmt, ihn bei uns aufzunehmen. Ich hoffe, ihr werdet ihm helfen, fabelhafte Ferien bei uns zu Hause zu verbringen.«
Die Heimkehr in den Schoß der Familie war ein Ereignis. Der Peugeot meines Vaters wurde im Sturm genommen, sobald er im Innenhof unserer Villa hielt. Meine Mutter kugelte wie ein Schneeball die Freitreppe hinunter, riss den Wagenschlag auf und umschlang mich mit ihren Armen, während Tante Milouda ihre gellenden Jubeltriller auf Wanderschaft durch die Nachbarschaft schickte. Die Familie hatte sich vollständig versammelt, meine Cousins aus Béchar waren da und meine Cousinen aus dem Viertel Victor-Hugo. Mein Onkel Ahmed hielt alle auf Abstand, die sich Kader, seinem Jungen, nähern wollten. Er wollte ihn zunächst einfach nur betrachten. Bebend vor Stolz, die Hände in die Hüften gestemmt, wie ein Hahn, der vor seinem Küken posiert, so stand er vor seinem Filius.
»Was habe ich euch gesagt!«, rief er aus, nachdem er tief eingeatmet hatte. »Sind sie nicht zum Anbeißen?«
Dann tätschelte er seinen Sohn und behielt ihn noch eine ganze Weile für sich. Ich hielt im allgemeinen Gewühl nach meinen Brüdern und meiner Schwester Ausschau, sah aber nur Abdeslem, der im Hausflur stand, die Augen kreisrund vor Glück. Jelloul wurde dieselbe Beachtung wie Kader und mir zuteil. Er wanderte von Brust zu Brust, ohne auch nur Zeit zum Atemholen zu finden. Man schubste uns ins Wohnzimmer, wo eine gewaltige Mahlzeit auf uns wartete. Wir waren viel zu glücklich, um sie zu würdigen. Mein kleiner Bruder Houari schaffte es endlich, sich einen Weg zu mir zu bahnen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen und Schmollmund musterte er meine prächtige feldgraue Uniform, auf der zwölf vergoldete Knöpfe prangten, mein maßgefertigtes Barett und meine glänzenden Halbstiefel, drehte sich zu meinem Vater um und verlangte auf der Stelle dieselbe Ausstaffierung. Man versuchte, es ihm zu erklären; er wollte nichts hören und stieß den für ihn so typischen Schrei des verwöhnten Fratzes aus, der mich normalerweise zur Weißglut brachte, an jenem Tag aber rührte und für allgemeine Heiterkeit sorgte.
Nachdem das erste Wiedersehensfieber sich gelegt hatte, nahm meine Mutter mich mit in ihr Schlafzimmer, um mir das neueste Baby zu präsentieren: ein Mädchen mit Namen Saliha. Sie strampelte in ihrer Wiege, und ihre kleinen Fäuste spielten mit einem Stück Vorhang. Zögernd streichelte ich ihr Gesichtchen. Sie zuckte kurz zusammen, hörte auf zu zappeln und drehte sich zu mir um. Ihre dunklen Äugchen musterten mich voller Neugier, dann schenkte sie mir ihr schönstes Lächeln. Ich war entzückt. Jetzt war ich wirklich zu Hause angekommen.
Zwei Missklänge allerdings gab es an diesem ersten Ferientag. Da war zum einen die Nachricht vom Tod meines Hundes Rex. Zum anderen diese eigentlich ganz banale, etwas ungeschickte Bemerkung meiner Mutter – die letztlich doch nicht ganz so belanglos gewesen sein kann, sonst hätte sie sich kaum meinem Gedächtnis eingegraben. Wir saßen alle beim Abendessen. Houari, der begehrlich auf eine prächtige Birne ganz oben im Fruchtkorb schielte, lief schon das Wasser im Munde zusammen. Meine Mutter, die ahnte, was gleich kommen würde, ermahnte ihn, die Birne mir zu überlassen:
»Ehre deinen älteren Bruder!«, herrschte sie ihn an, »vergiss nicht, dass er unser Gast ist!«
Unser Gast ?
Diese Art von Respektsbekundung hatte mir ganz und gar nicht gefallen.
Am nächsten Tag wurde ich von meinem Vater vorgeladen. Er saß im Wohnzimmer im Sessel und war damit beschäftigt, sich die Brille mit Durchschlagpapier zu putzen. Ich klopfte an die offene Tür und nahm Haltung an.
»Dazu bist du nicht verpflichtet, weißt du«, bemerkte er.
Ich ging automatisch in die Ruhestellung über, mit gespreizten Beinen und den Händen hinter dem Rücken.
Er lächelte.
»Komm näher.«
Als ich mich nicht rührte, erhob er sich und kam, um mich an sich zu drücken.
»Nimm’s mir nicht übel, Sohnemann. Es ist alles nur zu deinem Besten.«
»Ich nehme dir nichts übel.«
Er trat ein paar Schritte zurück und musterte mich von oben bis unten.
»Du solltest dich besser ernähren.«
»Findest du, dass ich abgenommen habe?«
»Könnte schon sein.«
Er schob mir einen Geldschein in die Tasche.
»Danke«, erwiderte ich.
»Nichts zu danken, Sohnemann.« Dann fing er sich wieder, klatschte munter in die Hände und rief mir zu: »Was stellen wir denn nun mit unserem Tag an, Herr Korporal? Entscheide du. Ich stehe zu Diensten.«
»Ganz wie du willst.«
»Hast du denn gar keine Vorstellung?«
»Nein.«
»Vertraust du mir?«
»Ja, natürlich.«
»Na, dann wollen wir mal. Mir nach!«
Er pferchte uns alle miteinander, Jelloul, Houari, Abdeslem, Kader, Homaïna, meinen kleinen Bruder Saïd und mich, in seinen Wagen und brach mit uns zu einer Stadtrundfahrt auf. Das Radio belferte in voller Lautstärke. Mein Vater war prächtiger Laune. Houari, der darauf bestanden hatte, vorne sitzen zu dürfen, drehte sich um und fing an, uns mit seinen Grimassen zu nerven. In meiner Abwesenheit war er zum Liebling der Familie avanciert und wollte das auch bleiben. Es war ein schöner Tag zum Jahresende, mit einem makellosen Himmel und einer für die Jahreszeit sehr gnädigen Sonne. Jelloul war überwältigt von den gewaltigen Gebäuden und den blinkenden Neonschildern, die die Ladeneingänge mit bunten Lichttupfern verzierten, den Vitrinen und Schaufensterauslagen, in denen es funkelte wie in Ali Babas Höhle. Er war in einem abgelegenen Nest zur Welt gekommen, dem zu Kriegszeiten übel mitgespielt worden war, und entdeckte nun Oran, die schönste Stadt des Landes. Dauernd stieß er mir den Ellenbogen in die Rippen, so beeindruckt war er von den Menschenmassen, die die Avenuen entlang flanierten, und vom schwindelerregenden Slalom der Autofahrer. Mein Vater spendierte uns Krapfen auf einem kleinen Platz und lud uns dann in den Zoo ein, um die wilden Tiere zu sehen. Erst bei Einbruch der Dunkelheit kehrten wir nach Hause zurück, glücklich und völlig erschöpft.
Die erste Woche verging wie im Rausch. Die Verwandtenbesuche rissen nicht ab, jeder wollte wissen, wie die kleinen Soldaten vom Mechouar denn nun aussahen. Die einen waren gerührt, die anderen eher skeptisch. Letztere deuteten an, dass es wohl doch keine gute Idee sei, so kleinen Jungs das Schönste überhaupt wegzunehmen, ihre Kindheit, und ihnen ohne ihr Wissen ein Schicksal aufzubürden, für das sie nicht zwangsläufig geschaffen waren. Meine Mutter zuckte die Achseln. Aus ihrer Sicht waren das alles nur Neidhammel. Driss, mein Onkel, war jedenfalls hingerissen. Er war ein flotter junger Mann, Anfang Zwanzig, ein begeisterter Krimileser; jeden Abend spendierte er uns Kinokarten. Manchmal bat er uns auch, in unsere Uniformen zu schlüpfen, und nahm uns mit in die Stadt, um bei den Mädels Eindruck zu schinden. Die jungen Damen konnten unserem Charme nicht widerstehen. In Sachen Verführung erwiesen wir uns als wirkungsvolle Köder. Dann ließ die Sache langsam nach. Jeder kehrte zu seinen Alltagsaufgaben zurück, und wir konnten endlich selbst über unsere Zeit verfügen. Kader beschloss, bei seiner Familie zu bleiben. Ich kümmerte mich um Jelloul. Mit meinem Taschengeld schleppte ich ihn überall hin, zeigte ihm die Küstenpromenade, die Hochhäuser, den Hafen, das Fußballstadion, die historischen Viertel, das Mausoleum von Sidi el Houari und die alten maurischen Bäder. Je zufriedener er war, umso mehr fühlte ich mich angespornt. Wir standen morgens beim ersten Hahnenschrei auf, schlangen unser Frühstück hinunter und los ging’s, der Eroberung El Bahias entgegen. Ich kannte jeden Winkel der Stadt, Jelloul konnte es gar nicht fassen. Er war überglücklich, fand alles interessant, wollte mehr über dieses und jenes wissen, war unermüdlich und entdeckungslustig. Ich glaube, er fand mich damals echt klasse, weil ich ihm so viele tolle Erlebnisse verschaffte. Er umarmte mich laufend und dankte mir dafür, dass ich mir so viel Zeit für ihn nahm, denn ich schlug ihm wirklich nichts ab. Selbst wenn ich eigentlich schon nicht mehr konnte, hatte ich doch jedes Mal noch jene Extraportion Elan, um ihn an jeden Ort, an den er wollte, zu bringen, ganz egal, wie früh oder spät es war. Sein Glück ließ mich ein Gefühl der Ganzheit und Fülle erfahren. Es machte mich glücklich, ihn glücklich zu machen. Und ich war auch stolz auf mich. Und eines Tages, da traf ich auf einem Stück Ödland ein paar ehemalige Klassenkameraden an, die dort auf Stieglitzjagd gingen. Mit einem Topf Leim gerüstet, den sie aus den geschmolzenen Nuckeln von Säuglingsfläschchen hergestellt hatten, versteckten sie ihre Fallen geschickt im Gebüsch und warteten, dass die Vögel ihnen dort auf den Leim gehen würden. Da sie in großer Armut lebten und ganz auf sich selbst gestellt waren, machten sie aus diesem fragwürdigen Zeitvertreib ihren Gelderwerb. Da gab es Redouane, den Sohn des Schuhmachers; Abbas, dessen Vater behindert war; einen Jungen, der den kuriosen Spitznamen Zit-Zit trug, und Berretcha, den unbelehrbaren Adepten des Schuleschwänzens, der ebenso wenig an den Nutzen des Lernens glaubte wie an die Verheißungen glücklicher Vorzeichen. Berretcha wohnte in einem Elendsquartier in unserer Nähe inmitten einer kunterbunten Geschwisterschar. Sein Vater war notorischer Alkoholiker und Dauergast in den Ausnüchterungszellen der städtischen Polizeireviere. Seine Mutter, eine robuste Amazone mit grünen Tätowierungen im Gesicht, handelte mit Second-Hand-Textilien auf dem Souk von Mdina Jdida und hatte häufig Scherereien mit der Polizei. Es gelang Berretcha nicht, mit der eigenen Familie warm zu werden, und im Unterricht pennte er ständig ein. Als er genug vom geballten Unmut der Lehrer hatte, schmiss er die Schule mit Schmackes hin und wählte das Vagantenleben. Mit schwungvoller Haarpracht und schuppiger Schnupfennase lernte er, unter freiem Himmel zu schlafen und sich ohne Familie durchzuschlagen – und wen kümmerte das schon? Er lebte von kleinen Aufträgen und Botengängen, die man ihm dann und wann übertrug, und manchmal auch vom Betteln. Ich traf ihn regelmäßig vor unserer Haustür an, wie er krümelige Kippen rauchte oder sich Flüssigkeiten mit kuriosen Ausdünstungen einflößte. Da er recht unterhaltsam und nicht die Spur raffgierig war, bot ich ihm hin und wieder an, die Nacht in unserer Waschküche zu verbringen. Zum Dank überließ er mir für ein Stück Brot breitwillig den Nippes, den er in den Tiefen der Mülltonnen auftat.
Читать дальше