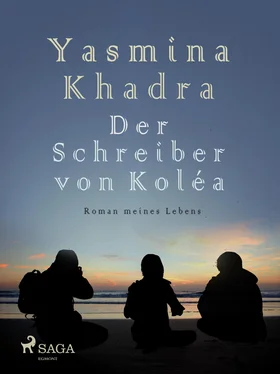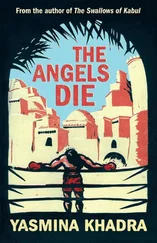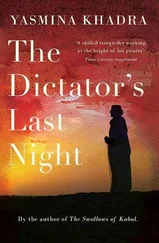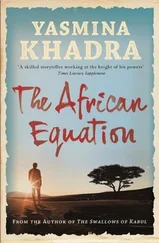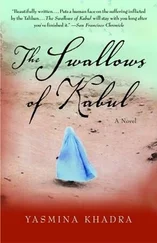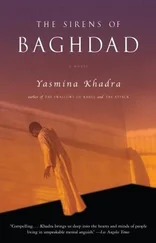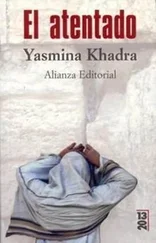Am Nachmittag rief man uns mit den neuen Rekruten in einem kleinen Hof zusammen. Dort trug man unsere Namen und Vornamen in ein Register ein, reihte uns der Größe nach auf, die Kleinen voran, und dann – wurden wir durchnummeriert.
»Von heute an nennt ihr eure Matrikelnummer, wenn man euch fragt, wer ihr seid«, erklärte uns ein Feldwebel, ein baumlanger Kerl mit Goldzähnen, der fortwährend die Kordel seiner Trillerpfeife knetete, während er uns argwöhnisch überwachte. »Keine Familiennamen und keine Spitznamen mehr. Keine Kungeleien und keine Extrawürste! Ab sofort seid ihr Soldaten und benehmt euch wie Soldaten. Viele von euch haben keine Familie, kein Heim und keine Stütze mehr. Die sind nun ihre Sorgen los. Von ihren Ausbildern bekommen sie alles, was der Krieg ihnen genommen hat. Die Armee wird darüber wachen, dass es ihnen an nichts fehlt. Und das gilt ganz genauso für die anderen. Ihr seid hier alle gleich, egal ob arm oder reich, Beduine oder Städter, Waisenkind oder Soldatensohn. Hier wird niemand auf Kosten seiner Kameraden bevorzugt. Dafür verlangen wir von euch Disziplin, exemplarischen Gehorsam und unverbrüchliche Aufrichtigkeit. Wir bilden hier Männer aus, tapfere Männer, die der algerischen Nation würdig sind, dieser Nation mit ihren anderthalb Millionen Märtyrern, die erst dann in Frieden ruhen werden, wenn wir ihnen bewiesen haben, dass ihr Opfer nicht vergebens war, sondern reiche Frucht trägt.«
Aus meinem Cousin wurde Matrikelnummer 122, aus mir die 129.
Zwei Tage später bekamen wir einen flaschengrünen Uniformrock, ein Barett, Trikots, Kampfstiefel für die großen und Kautschuksandalen für die kleineren Füße zugeteilt. Als wir uns vor einem Wandspiegel in Augenschein nahmen, entdeckten wir allerliebste kleine Bleisoldaten, die sich darin übten, lauthals ihre Identifikationsnummer zu skandieren, während sie in tadellosem militärischem Gruß die Hand an die Schläfe führten. Wir waren Nummer 19, Nummer 43, Nummer 72, Nummer 120 und sonst nichts. Wir hatten aufgehört, für uns selbst zu existieren. Wir waren zu Kadetten geworden – zu den Adoptivkindern der Revolution und der Armee.
Ich weiß nicht, ob ich übermäßig unter meiner Gefangenschaft gelitten habe. Ich war ja noch ein Kind. Mein Leben sah nun einmal so aus. Wenn schon die Erwachsenen daran nichts ändern konnten, was vermochte dann ein kleiner Junge auszurichten? Ich musste es nehmen, wie es kam. Meine Jugend und meine hundertdreißig Zentimeter waren hinreichende Entschuldigungsgründe. Ich durfte die Dinge so sein lassen, wie sie waren.
Einige Wochen hatten genügt, um mich zur Raison zu bringen.
Ich verspürte nicht mehr diesen unbändigen Drang, mich schmollend gegenüber dem großen Tor aufzubauen, wartete nicht mehr darauf, dass die hohen Festungsmauern krachend einstürzten und mich in die Freiheit entließen. Lange genug hatte ich nur zugeschaut, wie die anderen sich ihre eigene Welt erschufen, wie sie johlend Fußbälle aus Stoffresten durch die Gegend kickten, und mich ihnen irgendwann dann doch noch angeschlossen. Es brachte nichts, sich weiterhin selbst zu bemitleiden und ständig auszugrenzen. Auch die mächtigen Platanen hatten mir nichts als ihr Schweigen zu bieten. Und wenn ich mich noch so sehr im Winkel verkroch und fingerknetend alle Heiligen des Landes um Beistand anrief, irgendwann holte das Signalhorn mich doch wieder ein. Dann musste ich presto sämtliche Stoßgebete in die Ecke schieben und mich schleunigst meinem Trupp anschließen. Es wäre mir gar nicht gut bekommen, mir die Befehle, die auf uns einprasselten, erst noch wiederholen zu lassen.
Mein Cousin Kader hatte sich wesentlich schneller als ich akklimatisiert. Ich nehme an, mit sieben hat man es da einfach leichter. Er hatte schon seinen festen Platz in einer kleinen Fußballmannschaft und entpuppte sich als tüchtiger Torwart. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er aus nächster Nähe Torschüsse abfing oder, sich einem Gerangel entwindend, auf einen Ball zuschnellte, flink, hoch konzentriert und von erstaunlichem Kampfgeist beseelt. Ich dagegen war viel lieber mit Moumen zusammen, einem fabelhaften kleinen Kerl aus Perrégaux. Ein wenig dicklich war er, mit Bauchansatz und Nasenlöchern, die fast so breit wie sein Lächeln waren. Er faszinierte mich mit den abenteuerlichen Geschichten von seiner Angebeteten, die er wieder und wieder aus den Fängen eines launenhaften, grölenden Monsters befreien musste. Fesselnde Momente waren das. Moumen ersetzte uns den Märchenprinzen. Wir waren ein Dutzend Bengel, die sich nach dem Abendessen auf dem Treppenabsatz vor unserem Schlafsaal um ihn scharten, um immer ein neues Kapitel seiner atemberaubenden Geschichten zu hören, die alle auf dieselbe Art und Weise begannen und endeten, ohne dass wir ihrer je überdrüssig wurden. Unwillkürlich zitterten wir um unseren Helden, der sich mit gezücktem Krummsäbel auf sein weißes Maultier schwang und in den finsteren Wald hineingaloppierte, um seine Herzensdame zu suchen. Wenn es ihm am Ende gelang, den grausigen Menschenräuber zu stellen, flehten wir ihn an, ihn ohne langen Prozess zu enthaupten. Moumen war zwölf Jahre alt, und seine überschäumende Fantasie ein wesentliches Element meiner Eingewöhnung. Ich wurde sein bester Freund. Er übernahm es, mir meine Mutter zu ersetzen, die mir abends vorm Kamin, bei uns zu Hause, immer Geschichten erzählte …
Mein Gott, wie weit war das weg, unser Haus, mein Zuhause …
Wir wohnten in Choupot, einem ruhigen Viertel von Oran, in der Rue Aristide-Briand, Nummer 6. Unsere Villa war geräumig und lichtdurchflutet. Meine Brüder und ich spielten oft und gern Indianer. Mit einer Feder im Haar und roten Lippenstiftstrichen als Kriegsbemalung hielt ich mich für den Häuptling der Sioux. Wir hatten auch eine Garage, die als Bank herhalten musste, wenn wir wie im Gangsterfilm Bankräuber spielten. Und wir hatten einen Geflügelhof, wo wir Hühner, Gänse, Enten und Puten hielten, denn meine Mutter, eine romantische Beduinenseele, breitete ihr Landleben überall dort aus, wo sie sich niederließ – sehr zum Leidwesen meines Vaters, der vergeblich versuchte, sie zu größerer Urbanität zu bekehren. Über dem kleinen Patio, über den zwei ineinander verschlungene Zitronenbäume wachten, wucherte der Wein bis auf die Straße. Im Sommer verwandelten üppige Muskattrauben den Ort in ein wahres Schlaraffenland. Straßenbengel und Passanten mussten sich nur auf die Zehenspitzen stellen, um sich zu bedienen. Es gab Trauben in Hülle und Fülle. Wir gaben unseren Nachbarn, unseren Besuchern und den Bettlern davon ab, und von dem, was dann noch übrig blieb, verfertigte meine Mutter Konfitüren, die jeden Gaumen entzückten …
Ich verstand nicht, was mir widerfuhr.
Ich war doch so glücklich gewesen, bei uns zu Hause .
Früher hatte ich auf diese Dinge nie geachtet, sie fielen mir einfach nicht auf. Aber seit ich hinter den hohen Mauern des Mechouar lebte, wurde alles auf einen Schlag wieder höchst lebendig, selbst die belanglosesten Details: die rasenden Eifersuchtsanfälle meines Bruders Houari, unsere chronischen Raufereien; die Anhänglichkeit meines Hundes Rex; der kleine Laden an der Ecke, dessen Inhaber den vorwitzigen Poltergeistern, die seine Bonbongläser plünderten, auflauerte; die Wutausbrüche des Briefträgers, wenn er uns dabei erwischte, wie wir ihn hinter seinem Rücken nachäfften; die zwerchfellerschütternde Wampe des Schutzmanns; Negus, der alte hirnlose Landstreicher, der uns für zwei lumpige Kröten seinen phänomenalen Phallus vorführte und für einen Kanten Brot seinen Allerwertesten – all das fehlte mir, entzog sich mir, rief nach mir.
Vor allem aber begriff ich nicht, warum ausgerechnet ich unter Waisenkindern leben musste, ich, der ich einen einflussreichen Vater hatte, eine weitverzweigte Familie und eine Mutter, die mich heiß und innig liebte …
Читать дальше