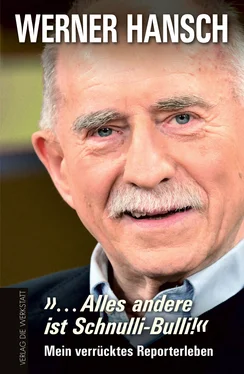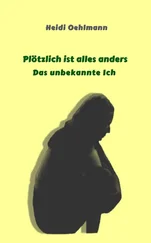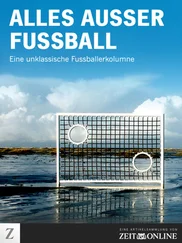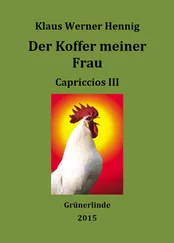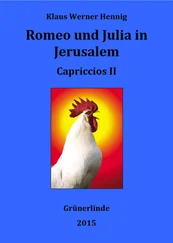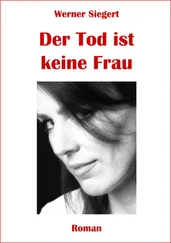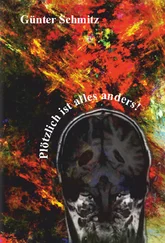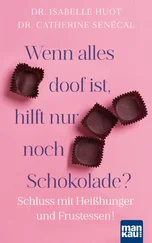Eine andere Auseinandersetzung mit meinen Eltern rückte in jener Zeit unaufhaltsam näher. Im Jahr 1952, als ich fast vierzehn war, endete für mich die Volksschule, wie damals üblich nach acht Schuljahren. Früher oder später musste eine Entscheidung über meine Zukunft fallen. So saßen wir schließlich an einem Tag im Frühjahr um den Küchentisch – meine Eltern, Zita und ich.
„Was ist denn nun mit dem Jungen, Stefan?“, sagte meine Mutter zu meinem Vater. „Der geht ja bald von der Marienschule ab. Was soll denn aus ihm werden?“
„Na, was wohl?“, erwiderte der Alte. „Der geht auf’n Pütt.“
„Nein“, rief ich, „das will ich aber nicht!“
Da ließ mein Vater Gabel und Messer fallen und blickte meine Schwester an. „Fahr in die Stadt!“, befahl er ihr mit richtig wütender Stimme. „Fahr in die Stadt und melde ihn beim Gymnasium an.“ Die Stadt, das war Recklinghausen. Wir wohnten ja in Recklinghausen Süd, wo die Malocher und Proleten lebten. In der Vorstellung meines Vaters war „die Stadt“ der Ort, wo Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte und Direktoren wohnten.
Die besagte Schule heißt heute Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Damals war es ein sogenanntes Aufbaugymnasium. Das bedeutete, dass es auf die Volksschule aufbaute und man dort nach sechs Jahren das Abitur machen konnte. Es gab auch noch die Gymnasien Hittorf und Petrinum in Recklinghausen, aber die kamen für mich nicht infrage. Denn auf sie hätte man schon nach der vierten Klasse wechseln müssen.
„Melde ihn an“, sagte mein Vater noch einmal zu Zita. „Dann muss er eine Prüfung machen – und die besteht er sowieso nicht.“ Er irrte sich. Ich bestand sie.
Das Wunder von Bern findet ohne mich statt
Etwas mehr als zwei Jahre nach diesem wichtigen Moment in meinem Leben lief ich mit meinem Freund Günther durch die Kneipe seiner Eltern. Das heißt, so richtig laufen konnten wir nicht, denn es war sehr voll. Günthers Vater hatte fast so etwas wie einen Altar aufgebaut. Da stand ein Tisch, auf ihm eine Konsole und darauf wiederum ein Fernseher. Und um den drängte sich nun nahezu die gesamte männliche Nachbarschaft. Der Fernseher war so wichtig, dass Günthers Vater von den Erwachsenen sogar 50 Pfennig Eintritt nehmen konnte, damit sie ihn anstarren durften.
Es war der 4. Juli 1954. Im Fernsehen lief das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Ungarn und Deutschland. Gerne würde ich sagen können, dass ich gebannt vor dem Fernseher saß. Oder vielleicht noch besser: dass ich an diesem Sonntag vor dem Radio hockte und fasziniert der berühmtesten deutschen Fußballreportage lauschte, Herbert Zimmermanns atemlosem Bericht aus dem Berner Wankdorfstadion. Vielleicht sogar, dass diese Übertragung in mir den Wunsch weckte, mit meiner Stimme auch solche Bilder zu malen. Doch nichts dergleichen. Günther und ich würdigten den Fernseher keines Blickes. Fußball interessierte uns nicht. Selbst als die Männer alle schrien und uns erzählten, wir wären Weltmeister geworden, zuckten wir nur mit den Achseln. Na und?
Natürlich haben wir Jungs gepöhlt, als wir zehn, elf Jahre alt waren. Leusbergstraße gegen Neustraße, das waren kleine Feste für die Kinder der Nachbarschaft. Da wurde vorher sogar richtig trainiert, damit man sich gegen die anderen nicht blamierte! Gespielt wurde wirklich auf der Straße. Das war kein Problem, denn es gab in der ganzen Gegend nur ein einziges Auto, das gehörte dem Milchbauern. Der kam zweimal am Tag, und dann musste man kurz Pause machen. Aber sonst war die Straße frei. Es wurden zwei Tore durch Tornister markiert, und los ging’s.
Das Dumme war bloß: Ich durfte nie mitspielen. Ich war zwar schnell, aber ich hatte überhaupt kein Ballgefühl und fiel gerne mal über meine eigenen Beine beim Versuch, einen Pass zu spielen. Wenn Nawrath und Limbach, die beiden Stars unserer Straße, ihre Mannschaften wählten – „Ich nehm’ den“, „Dann nehm’ ich den“ –, blieb ich immer übrig. Beim Spiel stand ich hinter dem Tor und musste die selbstgebastelten Bälle wiederholen, wenn jemand vorbeigeschossen hatte. Das war nicht schön, und wahrscheinlich hat es mir den Zugang zum Spiel etwas verbaut. Die Tatsache, dass ich die Namen Nawrath und Limbach auch sieben Jahrzehnte später noch parat habe, spricht Bände.
Später gab es bei uns mal so einen DJK-Verein, die katholische Deutsche Jugendkraft, und einer in dem Klub hatte die Idee, dass man meine Schnelligkeit gebrauchen könnte. Ich habe dann einoder zweimal auf der Außenbahn gespielt, aber es war fürchterlich. Fußball war nichts für mich. Das Spiel ging mir gepflegt am Allerwertesten vorbei.
Wie schon angedeutet, konnte ich aber sehr gut laufen. Auf der Penne war ich ein relativ guter Leichtathlet und trat dann 1953 auch Viktoria Recklinghausen bei. Ich glaube, ich hätte durchaus einiges erreichen können, wenn wir damals professionelles Training gehabt hätten. Aber wir besaßen ja noch nicht einmal Spikes. Der Trainer betrieb eine Lotto-Annahmestelle und kümmerte sich nur so nebenbei um uns. Von Süd waren es gut sechs Kilometer bis in die Stadt, zum Verein. Ich fuhr mit dem Fahrrad, und am Schluss ging es nur noch bergauf. Da kam ich oft schon halbtot beim Training an.
So stümperhaft das Training auch war, ich habe den Sport mit Leidenschaft betrieben. Ich war ein so großer Leichtathletikfan, wie man heute sagen würde, dass ich sogar zu den Länderkämpfen gefahren bin, die es damals noch gab und die meistens in Düsseldorf stattfanden. Es war die große Zeit der Leichtathletik, denn seinerzeit war der Fußball noch nicht die alleinherrschende sportliche Macht. Ich habe Herbert Schade gesehen, den schmächtigen Langstreckler aus Solingen, oder Karl-Friedrich Haas. 400-Meter-Läufer wie er waren so ein bisschen meine Idole. Aber Fußballer? Nein, nicht einmal die Helden von Bern.
Trotzdem ist mir der Tag des Endspiels noch gut in Erinnerung. Es war nämlich einer der letzten, in denen unsere kleine Welt – vom dritten Stock bis zur Kneipe unten – noch in Ordnung war. Denn schon im folgenden Jahr, also 1955, gab es den schweren Unfall. Meine Schwester Zita war mit den Wirtsleuten, Günthers Eltern, in deren Wagen unterwegs auf dem Ruhrschnellweg, heute die A 40. Ungefähr auf der Höhe von Dortmund-Hombruch verlor ein stark angetrunkener Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Wagen der Wirtsleute.
Günthers Mutter war auf der Stelle tot. Ihr Mann und meine Schwester wurden schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Zita hatte bei dem Unfall einen Beckenbruch erlitten, der dann leider nicht nach allen Regeln der modernen ärztlichen Kunst behandelt wurde. Beim Eingipsen muss etwas schiefgelaufen sein, jedenfalls wuchs ihr Becken nicht wieder sauber zusammen. Fortan hinkte sie leicht. Aber immerhin überlebte sie – Günthers Vater tat es nicht. Zwei Wochen nach dem Unfall starb er im Krankenhaus an einer Fettembolie, also dem Verschluss eines Blutgefäßes durch kleine Tröpfchen Körperfett.
Auf einmal stand Günther ohne Eltern da und war im Alter von gerade mal siebzehn Jahren zum Besitzer einer Kneipe und eines großen Mietshauses geworden. Er hat versucht, die Kneipe weiterzuführen, aber nach und nach ging alles den Bach runter. Er fing an zu trinken, dann kamen komplizierte Weibergeschichten dazu. Schließlich setzte ihm jemand einen Floh ins Ohr und schwatzte ihm eine Hühnerfarm auf.
Das klingt heute abwegiger, als es damals war. Eine Zeit lang, in der zweiten Hälfte der 1950er, war das eine beliebte Geschäftsidee. Man konnte Geld verdienen mit den Eiern der Hühner und ihrem Fleisch, vor allem, wenn man viele hatte. Und Günther hatte viele. Zweitausend! Leider hatte Günther keine Ahnung von Hühnern und auch keine Disziplin. Er blieb oft nächtelang weg, wegen Alkohol oder Frauen oder beidem, und viele Hühner verendeten elendig. Bald beschwerten sich die Nachbarn wegen des Gestanks, und die Stadt schloss die Hühnerfarm. Es war ein finanzielles Fiasko für Günther, nicht das letzte. Am Schluss war er pleite, und das Haus wurde zwangsversteigert. Was aus ihm wurde? Keine Ahnung, er ist spurlos verschwunden.
Читать дальше