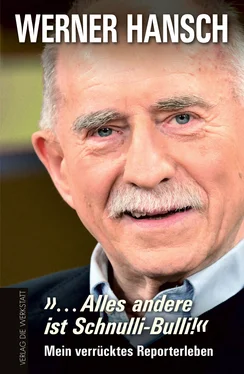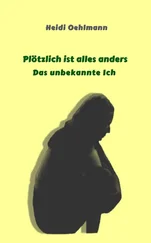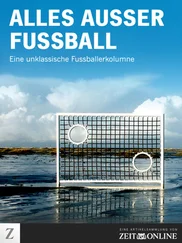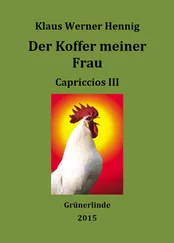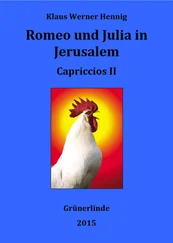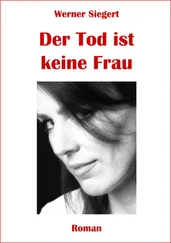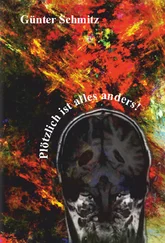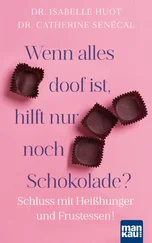Im Sommer zuvor, im Mai oder Juni 1932, hatte ein alter Bekannter meines Vaters, der Skomski genannt wurde, ihn gedrängt, Sprengstoff zu besorgen. Stefan Hansch arbeitete damals auf der Zeche Consolidation in Gelsenkirchen-Schalke. (Als ich das in den Akten las, hätte ich fast laut gerufen: „Natürlich Schalke! Wo sonst?“) Er war Gesteinshauer und hatte deswegen Zugang zu solchen Materialien. Nach anfänglichem Zögern tat er Skomski den Gefallen. Natürlich wusste mein Vater, dass Skomski Mitglied des Rotfrontkämpferbundes war und den Sprengstoff für einen Anschlag oder sogar einen bewaffneten Aufstand brauchte.
Ein paar Monate, nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, wurden Skomski und viele andere Mitglieder der Verschwörung verhaftet. Mein Vater hatte zunächst Glück; niemand verpfiff ihn. Doch man kann sich vorstellen, zu welchen Methoden die Nazis bei der Vernehmung der Kommunisten griffen. Nach vier Monaten in der Untersuchungshaft (und vermutlich unter Folter) gab Skomski zu, bei seiner ersten Vernehmung nicht die ganze Wahrheit gesagt zu haben. Er nannte jetzt weitere Namen, und drei Tage später wurde Stefan Hansch verhaftet. Beim Verhör gab mein Vater alles zu. In der Niederschrift seiner Aussage heißt es: „Meine damalige Handlung bereue ich aufrichtig, ich sehe aber ein, dass ich Strafe verdient habe.“ Menschen, die sich mit diesen Dingen auskennen, haben mir gesagt, dass eine solche Formulierung darauf hindeutet, dass mein Vater seine Aussage unter der Einwirkung oder Androhung von Gewalt gemacht hat.
Der Prozess fand im Frühling 1934 vor dem Oberlandesgericht Hamm statt. Unter den Nazis war das OLG Hamm vor allem für politische Verfahren zuständig. Mein Vater war zusammen mit gleich 28 anderen Personen angeklagt. Die meisten von ihnen waren Bergleute aus Recklinghausen und Westerholt, einem Stadtteil von Herten. Bei dieser großen Zahl von Beschuldigten sollte man meinen, dass es sich um eine spektakuläre, langwierige Verhandlung handelte. Doch im Archiv der Recklinghäuser Zeitung lässt sich keine einzige Zeile darüber finden. Es ist also gut möglich, dass der Prozess, wenn man ihn überhaupt so nennen will, nicht öffentlich war und die Angeklagten keinen Rechtsbeistand hatten.
Nur drei von ihnen kamen ohne Strafe davon, die anderen wurden am 27. April 1934 wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Einige der Männer wurden mit fünf Jahren Zuchthaus bestraft, für „Beteiligung am Rotfrontkämpferbund, ein Schusswaffenvergehen und ein Sprengstoffverbrechen“. Mein Vater kam besser davon. Ihm wurde nur das Sprengstoffverbrechen zur Last gelegt. Das Urteil lautete auf zwei Jahre Haft, allerdings wurden ihm von dieser Strafe die Monate abgezogen, die er bereits in der Untersuchungshaft verbüßt hatte.
Wenige Tage nach dem Urteilsspruch wurde Stefan Hansch vom Gerichtsgefängnis Hamm in die Strafanstalt Münster gebracht. Auf seiner Karteikarte ist vermerkt, dass er 1,78 Meter groß und von kräftiger Gestalt war, einen Schnurrbart trug und seine Initialen auf die rechte Hand tätowiert hatte. Auf der Karte steht ebenfalls, dass er zwanzig Monate später entlassen wurde, am 27. Dezember 1935 um 7.30 Uhr morgens.
Jetzt, wo ich in einem Alter bin, in dem ich auf mein eigenes, wechselhaftes Leben zurückblicke, schaue ich auf diese Karte und stelle mir Fragen. Mein Vater kam drei Tage nach Weihnachten aus dem Zuchthaus. Wie mag der Rest der Familie dieses Fest verbracht haben? Wovon hatten sie gelebt? Machte meine Mutter meinem Vater Vorwürfe? Versprach er ihr vielleicht, in Zukunft nichts mehr zu tun, was die Familie in Gefahr brachte – bis zu jenem verhängnisvollen Tag, als er zu viel trank?
Ich werde es nie wissen, denn ich kann niemanden aus meiner Familie fragen. Sie sind alle tot. Und der Einzige, der mir wirklich jede Frage hätte beantworten können, war im Grunde schon tot, als er noch lebte. Denn mein Vater war ja nicht nur vom Gefängnis gezeichnet, von den Schlägen mit dem Ochsenziemer und vom KZ. Auch seine Berufsvergangenheit forderte ihren Tribut – er wurde wegen einer Steinstaublunge frühpensioniert, als schwerkranker Mann. Und so kam er mir oft vor wie ein Fremder in unserer Mitte. Er saß mit seiner Pfeife im Sessel neben dem Radio und schaute stundenlang geradeaus, immer in dieselbe Richtung. Als ob er ins Nichts blicken würde. Oder vielleicht waren es auch Abgründe.
Dass mein Vater mir immer seltsam fremd blieb, habe ich mir selbst lange auch damit erklärt, dass ich im Grunde ohne ihn aufwuchs. In meiner Erinnerung kamen wir nach dem Ende des Krieges zurück in die Straße, die nun nicht mehr nach Hermann Göring benannt war, und da stand er plötzlich – mein Vater. Ich war fast sieben Jahre alt und sah einen von Entbehrungen gezeichneten Mann, den man gerade aus dem KZ entlassen hatte. Es war ein Fremder, ich war ihm ja nie zuvor begegnet. Seine Empfindungen mir gegenüber dürften ganz ähnlich gewesen sein, und irgendwie schafften wir es später nicht mehr, das aufzubauen, was man eine natürliche Nähe nennen könnte.
Nun aber kommt das Merkwürdige. Der Internationale Suchdienst in Bad Arolsen, ein Zentrum für Informationen über Verfolgung während der NS-Zeit, hat mir im Februar 2014 Dokumente über die KZ-Zeit meines Vaters geschickt. Aus ihnen geht hervor, dass Stefan Hansch am 21. Mai 1938 wegen „staatsfeindlicher Äußerungen“ verhaftet wurde. Die zwei Sätze, die ihn ins KZ brachten, lauteten: „Ich weiß gar nicht, wieso sie alle dem Hitler nachlaufen. Der ist doch auch bloß ein Arbeiter.“ Als man ihn deswegen zwei Wochen später nach Buchenwald brachte, wurde zwar auf seiner Häftlingspersonalkarte vermerkt, dass ihm das „in betrunkenem Zustand“ herausgerutscht war, aber vor Strafe schützte ihn dieser Umstand nicht.
Am Tag, als mein Vater nach Buchenwald kam, wurden außer ihm noch 51 andere Personen eingeliefert. Zwei von ihnen waren als sogenannte Bibelforscher verhaftet worden, was bedeutet, dass sie den Zeugen Jehovas angehörten. Sie waren dem Regime religiös unliebsam. Sechs weitere Gefangene galten als „Vorbeuge-Häftlinge“. Es steht zu vermuten, dass es sich bei ihnen um Kriminelle oder auch nur um mutmaßliche Kriminelle handelte, die ohne Gerichtsbeschluss einfach weggesperrt wurden. Die meisten der Gefangenen aber, fast drei Dutzend, hatte man als „arbeitsscheu“ festgenommen. So bezeichneten die Nazis Menschen aus der Unterschicht. Sie waren dem Regime sozial unliebsam.
Schließlich waren da noch acht politische Gefangene. Zu jener Zeit, im Sommer 1938, unterschied die SS in Buchenwald drei Gruppen von solchen Häftlingen: „einfache Politische“, „politisch Rückfällige“ und „politische Juden“. Von den acht politischen Gefangenen, die am 5. Juli ins KZ kamen, waren fünf „einfache Politische“, zwei weitere waren Juden. Wegen seiner Vorstrafe war Stefan Hansch der einzige, der als rückfälliger politischer Gefangener galt. Daher muss er eine KZ-Uniform bekommen haben, auf die ein roter Winkel (für: Politische) zusammen mit einem roten Streifen (für: Rückfällige) aufgenäht war.
Vom 20. September 1938 an wurde mein Vater dann nicht mehr als „rückfällig“ geführt, sondern als einfacher politischer Gefangener. Wie es dazu kam, kann ich nicht sagen. Vermutlich verhielt er sich konform, vielleicht spielte auch sein Gesundheitszustand eine Rolle, der zu dieser Zeit schon nicht gut gewesen sein kann. Im Oktober wurde er jedenfalls zum Gerichtsgefängnis Herne gebracht, wahrscheinlich zur Untersuchung seines Falles. Am 24. November schickte man ihn zurück nach Buchenwald, wo er eine neue Nummer bekam, die 895. Die Aufzeichnungen enden kaum drei Monate später, am 7. Februar 1939. Denn um 15 Uhr an diesem Tag wurde mein Vater zusammen mit 26 anderen Häftlingen aus dem KZ Buchenwald entlassen und nach Hause geschickt.
Ich war sehr, sehr erstaunt, als ich dies las. Das frühe Datum seiner Entlassung – sogar noch vor dem Kriegsbeginn – lässt nur drei Schlussfolgerungen zu. Entweder kehrte er vom KZ gar nicht nach Recklinghausen zurück und wurde zum Beispiel zur Wehrmacht eingezogen. Das ist allerdings unwahrscheinlich. Wohin hätte er gehen sollen, wenn nicht zu seiner Familie? Und für die Armee war er zu alt und zu krank. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich einfach keine Erinnerungen mehr daran habe, dass er zu uns auf den Leusberg zurückkam. Das kann durchaus sein, denn ich war ja erst ein halbes Jahr alt. Drittens ist es möglich, dass mein Vater nach Hause kam – aber seine Familie schon nicht mehr dort war.
Читать дальше