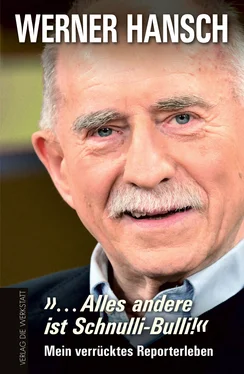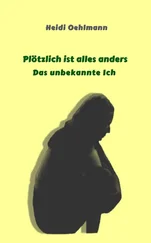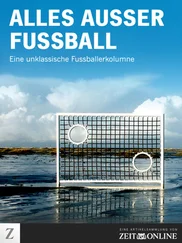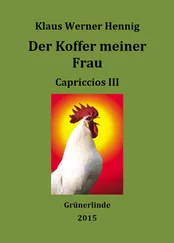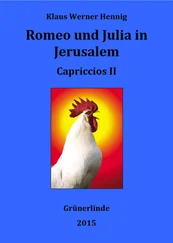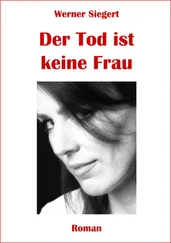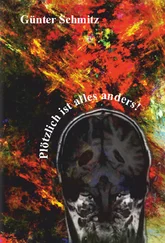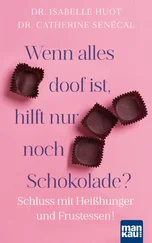Diese Wohnung befand sich in der Leusbergstraße, die allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so hieß. Wie zum Hohn wohnte die kleine Familie des renitenten Kommunisten Stefan Hansch damals in der Hermann-Göring-Straße Nummer 28.
Viele dieser Einzelheiten weiß ich erst seit kurzer Zeit. Als junger Bursche bekam ich durch Gesprächsfetzen mit, dass mein Vater im Gefängnis gewesen war. Von alten Leusbergern erfuhr ich zudem, dass er zu einer Gruppe von Kommunisten gehörte, die sich vor Hitlers Machtübernahme mit der SA Straßenkämpfe geliefert hatte. Diese Nachbarn – vor allem Tante Anni und Onkel Leo – erzählten mir, wie die Nazis meinen Vater und andere unliebsame Leute in regelmäßigen Abständen aufs Präsidium holten. Dort legte man sie über den Tisch, und sie bekamen Prügel mit dem Ochsenziemer, einer üblen Schlagwaffe.
Mir war auch dunkel bewusst, dass mein Vater in einem Konzentrationslager gewesen war. Das hing mit dem Schrank zusammen, den wir so um 1950 herum bekamen. Heute würde man das Ungetüm mit seiner wulstigen Leiste als „Gelsenkirchener Barock“ bezeichnen. Als der Schrank geliefert wurde, stand die halbe Straße staunend vor dem Möbelwagen und hat uns ganz offen darum beneidet, dass wir uns so etwas leisten konnten. Ich wunderte mich natürlich auch, und da sagte Tante Anni zu mir: „Das ist vom KZ. Dein Papa hat Entschädigung bekommen.“
Schließlich hörte ich gelegentlich von meinem Vater selbst, dass er unschöne Dinge erlebt hatte. Denn manchmal, wenn er in der Gaststätte, über der wir wohnten, zu viel getrunken hatte, weckte er mich mitten in der Nacht und sagte, ich solle in die Küche kommen. Dann saßen wir am Esstisch, und er berichtete mir einzelne Szenen. Ich erinnere mich noch, wie er mir erzählte, dass die sogenannten Kapos am schlimmsten waren, die Häftlinge, die man im KZ mit besonderen Aufgaben betraut hatte und die auf die anderen Gefangenen aufpassten. Doch in solchen Nächten fing mein Vater meistens bald an zu schluchzen. Der Alkohol tat ein Übriges, und rasch liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Ich saß dann einfach nur stumm auf meinem Stuhl und wartete geduldig, bis er endlich fertig war. Denn er steckte mir immer ein paar Mark zu, bevor er mich wieder ins Bett schickte.
Aber ich fragte meine Eltern nie von mir aus nach Einzelheiten oder nach den Hintergründen der ganzen Geschichte. Im Gegenteil, als junger Bursche neigte ich eher dazu, meinen Vater zu provozieren. Er war Mitglied in der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Einmal im Monat kam ein Mann namens Jakubowski zu uns, um den Mitgliedsbeitrag einzusammeln. Er war ein alter Genosse meines Vaters, und wenn ich an dem Tag zufällig in der Wohnung war, habe ich die beiden gerne auf die Palme gebracht. Ich lobte dann den christlich-konservativen Bundeskanzler Konrad Adenauer über den grünen Klee. Zum Teil, weil ich da tatsächlich noch ein glühender Anhänger von ihm war. Aber auch, weil ich wusste, dass sich meinem Alten die Nackenhaare aufstellten, ohne dass er etwas tun konnte. In einer politischen Diskussion war er mir rhetorisch unterlegen. „Mensch, Stefan“, sagte Jakubowski dann traurig zu meinem Vater, „da hast du dir aber einen großgezogen.“
Das klingt vielleicht schlimm, aber in jener Zeit war das normal – als Jugendlicher rebellierte man gegen die Generation davor und war von den Kriegsgeschichten nur gelangweilt. Und als sich das änderte, da war es für mich zu spät: Ich war noch keine 23 Jahre alt, als ich beide Elternteile verlor. Deswegen weiß ich über meine Familie, nicht bloß über meinen Vater und meine Mutter, weniger, als ich heute gerne wissen würde. Das Wenige, das mir bekannt ist, beginnt in einem Land, das in meinem Leben mehrfach eine besondere Rolle gespielt hat und mir sehr am Herzen liegt – Polen.
Bergmann, Kommunist, Oppositioneller
Mein Vater Stefan Hansch wurde am 18. August 1890 in Bielewo geboren. Das ist ein kleines polnisches Dorf, in dem zu jener Zeit weniger als 400 Menschen lebten und das zum Landkreis Kosten in der Provinz Posen gehörte. Wie ich selbst später auch, so muss er früh beide Eltern verloren haben. Das weiß ich allerdings nur aus Erzählungen, aber es erklärt, warum ich nie einen Großvater oder eine Großmutter väterlicherseits kennengelernt habe.
Zusammen mit einem Onkel kam mein Vater als ganz junger Kerl, kurz nach der Jahrhundertwende, auf der sogenannten Ost-West-Wanderung der polnischen Arbeiter ins Ruhrgebiet. Dort waren die Zechen wie Pilze aus dem Boden geschossen, und es wurden dringend Bergleute gesucht. Viele Polen wanderten sogar noch weiter, bis in die nordfranzösischen Kohlereviere. Deswegen hatten wir später Verwandte in Lille, die ich als Pennäler mal besucht habe. Mein Vater aber blieb in Recklinghausen hängen und fing auf dem Pütt an, mit vierzehn oder fünfzehn Jahren.
Als er dann in das Alter kam, in dem man damals eine Familie gründete, fuhr mein Vater zurück in die Heimat, um sich eine Frau zu suchen. Er fand sie in der Gegend um die Stadt Zielona Góra, die zu jener Zeit recht wörtlich übersetzt Grünberg hieß. Er kam mit ihr zurück nach Recklinghausen, denn hier hatte er ja Arbeit, und die beiden bekamen kurz hintereinander zwei Kinder: meine Halbbrüder Marian und Felix.
Als die zwei Jungs noch klein waren, starb ihre Mutter an Lungenentzündung. Mein Vater nahm seine beiden Söhne und fuhr mit ihnen nach Sulechów, den polnischen Ort, in dem seine Schwiegermutter lebte. Und dort ging alles dann ratzfatz. Die Schwiegermutter, meine Oma, sagte zu ihrer ältesten noch ledigen Tochter: „Wir können den Stefan nicht mit den Kindern allein lassen. Jetzt musst du ihn eben heiraten!“
Eine Ehe aus Liebe sieht sicher anders aus, doch damals war eine pragmatische Lösung des Problems eben wichtiger als romantische Gefühle. Ich nehme auch an, dass Magdalena Tomczak, meine Mutter, das Ganze als Chance begriff, dem perspektivlosen polnischen Landleben zu entkommen. Sie willigte ein und wurde im Juli 1913 die zweite Frau von Stefan Hansch.
Meine Oma wollte diese neue Familie nicht von Beginn an durch die Anwesenheit zweier kleiner Kinder belasten. Deswegen sollte einer der beiden Söhne zunächst bei ihr bleiben. Es traf Marian, und so kehrte mein Vater zusammen mit seiner neuen, sechs Jahre jüngeren Frau Magdalena und seinem Sohn Felix zurück ins Ruhrgebiet. Aus dieser Ehe gingen schließlich drei Kinder hervor. Meine Schwester Gertrud wurde 1920 geboren, meine Schwester Felicitas, genannt Zita, zwei Jahre später. Tja, und dann, mit gehörigem Abstand, wurde ich in diese Welt geworfen – am 16. August 1938. (Nicht am 19., wie man manchmal liest.)
Da ging es wohl schon los mit den Zufällen, die mein Leben bestimmen sollten. Denn man darf getrost davon ausgehen, dass ich ein überhaupt nicht mehr geplanter Nachzügler war. Meine Mutter war schließlich schon über 40, als sie noch einmal schwanger wurde, mein Vater ging auf die 50 zu. Dazu kamen natürlich noch die politischen Verhältnisse. Am 30. Januar 1933 war Hitler als Reichskanzler vereidigt worden, was die Lebensumstände für jemanden wie meinen Vater dramatisch verschlechterte. Etwas mehr als ein Jahr vor der sogenannten Machtergreifung der Nazis war er nicht nur der KPD beigetreten, sondern auch einer Gruppe, die sich Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition (RGO) nannte.
Wie so vieles, was meinen Vater betriftt, so weiß ich auch dies erst seit Kurzem – und zwar durch das Studium von Prozessakten. Ihnen entnehme ich auch, dass Stefan Hansch im Ersten Weltkrieg Soldat war und verwundet wurde. Mir hat er davon nie etwas erzählt, aber vielleicht hat ihm diese Tatsache ein wenig geholfen, als er Anfang September 1933 verhaftet wurde. Er konnte jedenfalls jeden mildernden Umstand gut gebrauchen, denn die Anklage lautete „Vorbereitung zum Hochverrat“.
Читать дальше