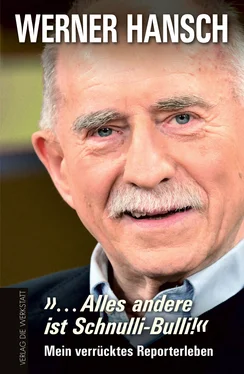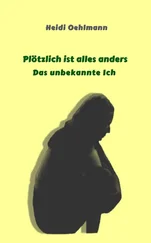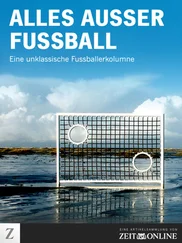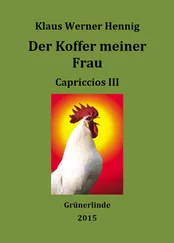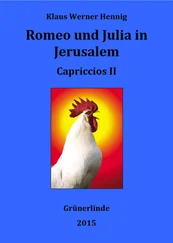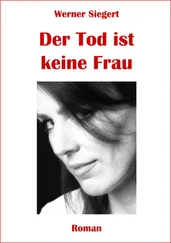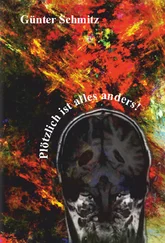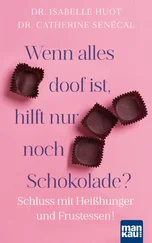Der Tag, an dem wir von Lütmarsen zurück nach Hause kamen, war in meiner bewussten Erinnerung der erste, an dem ich meinen Vater sah. Er war schon in unserer Wohnung in der Leusbergstraße, als wir eintrafen. Meine Mutter hatte mir nie richtig erklärt, warum mein Vater in den Jahren davor nicht bei uns gewesen war, und ich hatte sie nie danach gefragt. Ich nehme schon an, dass man mir eine kurze Erklärung gegeben hat, vermutlich ein lapidares „Er ist im Krieg“. Das dürfte mir gereicht haben, denn es war in jener Zeit ja normal, dass Väter von ihren Familien getrennt waren.
Auch Felix kam bald zurück. Er hatte Glück und verbrachte nur kurze Zeit in englischer Kriegsgefangenschaft. Da er aber nichts anderes als Soldat gelernt hatte, musste er sich nun als Handlanger verdingen. Den Rest seines Lebens arbeitete er fleißig und treu auf dem Bau. Er gründete eine Familie und wohnte später in Hochlarmark, einem Stadtteil im Süden von Recklinghausen. Er bekam drei Kinder, ich bin der Patenonkel von einem von ihnen.
Meinen anderen Halbbruder, Marian, habe ich hingegen nie zu Gesicht bekommen. Er gründete eine eigene Familie, aber in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ging der Kontakt zu ihm verloren. Bis zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung, was aus ihm geworden ist.
Die Leusbergstraße in Recklinghausen Süd
Mein Elternhaus, also die Leusbergstraße 28, liegt im Süden von Recklinghausen, ganz in der Nähe der Emscher und damit an der Stadtgrenze zu Herne. Das berühmte Stadion am Schloss Strünkede, die Heimat von Westfalia Herne, ist nur zwei Kilometer entfernt. Ich bin allerdings nie hingegangen, um Fußball zu sehen. Mit diesem Sport hatte ich überhaupt nichts am Hut, wie sich noch zeigen wird. Abgesehen davon war meine Kindheit allerdings geradezu eine Ruhrpottjugend aus dem Bilderbuch. Ich wuchs auf zwischen Eckkneipen, Brieftauben und Bergleuten.
Die Kneipe war sogar direkt unter uns. Wir wohnten im zweiten Stock, als eine von dreizehn Familien in dem Haus. Im Erdgeschoss befand sich die Kneipe. Hier spielte mein Vater mit seinen Kumpels gerne Doppelkopf, und ich war auch regelmäßig dort, denn ich war gut befreundet mit dem Sohn der Wirtsleute, Günther. Seinen Eltern gehörte nicht nur die Gaststätte, sondern das ganze Haus, sie waren also unsere Vermieter.
Die Kneipe war der gesellschaftliche Mittelpunkt des ganzen Viertels. Dazu gab es noch zwei Brieftaubenvereine: „Rote Erde“ und „Über Land und Meer“. Mein Vater hatte keine Brieftauben, aber Onkel Leo besaß ein paar dieser „Rennpferde des kleinen Mannes“. Sonntags musste ich für ihn oft die kantigen Spezialuhren, mit denen man die genaue Ankunftszeit der Brieftauben festhielt, zur Taubenzentrale bringen. Dort wurden die Ergebnisse dann ausgewertet.
Unsere Wohnung war klein, es gab nur einen Schlafraum und eine Wohnküche. Deswegen schlief ich bis zum Abitur im Schlafzimmer meiner Eltern. (Sie waren ja schon betagt und, ich will es mal so ausdrücken, von allem Weltlichen entfernt.) Trotz des beengten Raumes waren wir sogar zu viert in der Wohnung, denn auch meine Schwester Zita lebte bei uns. Das lag zum einen daran, dass sie unverheiratet war. Zum anderen daran, dass es auch meiner Mutter gesundheitlich nicht besonders gut ging. In den letzten Tagen des Krieges wäre sie an einer Darmverschlingung fast gestorben. Eine Not-OP bei Kerzenlicht hatte sie gerettet, doch seither musste sie dicke Bauchbänder tragen und konnte nicht einmal mehr einen Eimer Wasser heben. Deswegen führte Zita uns den Haushalt. Das war im Grunde ihr Beruf, nebenbei verdiente sie sich noch ab und zu etwas dadurch, dass sie unten in der Kneipe hinter der Theke aushalf. Sie übernachtete in einem winzigen, unbeheizten Raum unter dem Dach.
Das mag in heutigen Ohren wie eine traurige, entbehrungsreiche Jugend klingen, aber ich empfand es nicht so. Zum einen hatte ich noch eine zweite Familie, in die ich sozusagen ausweichen konnte, wenn es mir daheim zu eng wurde – die schon erwähnten Tante Anni und Onkel Leo.
Leo war so um 1920 herum, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, aus Berlin gekommen, weil er dort keine Zukunft für sich gesehen hatte. Er fand in Recklinghausen auf der Zeche Arbeit und holte später seine Frau Anni nach. Die beiden wohnten zunächst in unserem Haus, sogar auf unserem Flur. Sie waren zwar kinderlos, aber trotzdem – oder gerade deswegen – war Tante Anni total besessen von Kindern.
Als ich 1938 geboren wurde, war die Situation in der Familie wegen der Abwesenheit meines Vaters nicht die allerbeste. Ich kann nicht einmal erahnen, wie meine Mutter in dieser Zeit über die Runden gekommen ist. Vielleicht konnte mein Bruder Felix ihr etwas Geld geben, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist dies: Vom ersten Moment an war ich so etwas wie ein Sohnersatz für Tante Anni, und sie nahm meiner Mutter viel Arbeit ab. Tante Anni, stürzte sich mit überbordender Liebe auf mich und war fortan meine zweite Mutter. Manchmal war sie sogar wichtiger für mich als meine leibliche.
Einige Zeit vor dem Ende des Krieges zogen Tante Anni und Onkel Leo zwar aus unserem Haus weg – aber buchstäblich nur ein paar Häuser weiter, in die Emscherstraße. Dort ging ich ein und aus, als wäre ich ihr eigener Sohn.
Zudem muss man sagen, dass meine Kindheit verhältnismäßig sorgenfrei war, denn es ging unserer Familie finanziell gut. Neben der einmaligen KZ-Entschädigungszahlung, von der wir uns den besagten wuchtigen Schrank kauften, bezog mein Vater eine Knappschaftsrente und bekam auch die sogenannte Opferpension. Die war von der Adenauer-Regierung für Menschen eingeführt worden, die unter dem Naziterror gelitten hatten.
Im Vergleich zu den anderen Familien auf der Leusbergstraße standen wir also gut da, denn die lebten ja ausschließlich vom Lohn des jeweiligen Vaters – der in vier von fünf Fällen ein einfacher Bergmann war. Irgendwie waren alle auf der Zeche. Damals gab es allein in Recklinghausen vier davon. Auch mein Vater hat immer zu mir gesagt: „Du gehst auf den Pütt.“ Das war kein Befehl, sondern eine Feststellung. Es war eben so auf dem Leusberg. Die Männer arbeiteten auf der Zeche, und die Söhne folgten ihnen. Aus zwei Gründen. Erstens war das ein sicherer Arbeitsplatz. Zweitens gab es Kohlen. Jeden Winter bekamen die Bergleute zwanzig Zentner Deputat-Kohlen. Damit war die Bude immer warm, damals keineswegs eine Selbstverständlichkeit.
Ich aber wollte nicht auf den Pütt. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte es einfach nicht. Vielleicht war mir der körperliche Zustand, in dem sich mein Vater befand, eine Warnung. Jedenfalls war ich schon auf der Volksschule sehr ehrgeizig. Der Rektor Lübbert muss auch etwas in mir gesehen haben, denn ich bekam einige kleine Aufgaben. So verwaltete ich zum Beispiel die Schlüssel, und wenn es Bekanntmachungen gab, dann wurde ich mit einem Zettel durch die Klassen geschickt. Ja, man kann sagen, dass ich ein beflissener und ziemlich guter Schüler war. Das weckte in mir den Wunsch, etwas zu tun, was Jungs vom Leusberg eigentlich nicht taten. Ich wollte aufs Gymnasium gehen. Eine konkrete Berufsidee hatte ich dabei gar nicht, ich wollte einfach nur auf die höhere Schule.
Vielleicht störte es mich deswegen, dass meine Eltern sich untereinander auf Polnisch unterhielten. Dabei beherrschten sie die deutsche Sprache einwandfrei. Mein Vater sowieso, aber auch meine Mutter, die ja erst spät nach Deutschland gekommen war. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass sie jemals einen Akzent gehabt hätte. Sie sprach genauso gut Deutsch wie alle Nachbarn. Trotzdem redete sie Polnisch mit meinem Vater. Das erboste mich immer, und ich sagte: „Ihr sollt nicht Polnisch sprechen!“ Es gab nämlich auch eine Zeit, in der wir gehänselt wurden. „Rot und blau, Pollacks Frau“, solche Sachen riefen die Kinder. Es war mir also höchst unangenehm, an meine polnische Herkunft erinnert zu werden. Heute bin ich stolz auf sie, und ich bedauere es außerordentlich, dass ich nicht mehr Polnisch spreche. Manchmal kommen einzelne Wortfetzen in meiner Erinnerung hoch, aber das ist leider alles.
Читать дальше