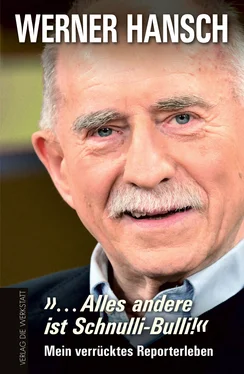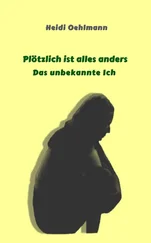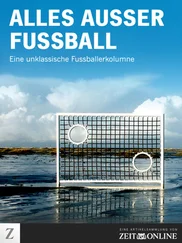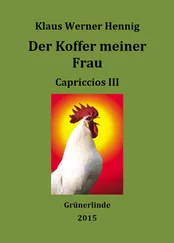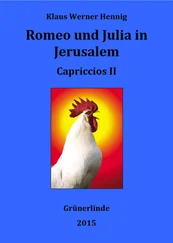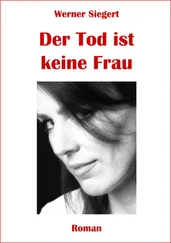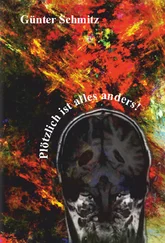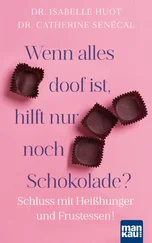Bis heute jammert mich Zitas Schicksal, und es gibt mir immer einen kleinen Stich ins Herz, wenn ich über sie spreche oder schreibe. Sie hatte kein einfaches Leben, und ich möchte behaupten, dass die Jahre mit Alfred die einzigen waren, in denen sie wirklich glücklich war. Sie weigerte sich, ihre kaputte Hüfte noch einmal operieren zu lassen, und ihre Verfassung verschlimmerte sich zusehends. Schließlich ging sie stark gebeugt, wie ein halbaufgeklapptes Taschenmesser. Weil sie in ihrer Wohnung immer wieder stürzte und vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste, kam sie schließlich in ein Pflegeheim. Sie blieb dort zehn Jahre lang. Die letzten fünf davon verbrachte sie nur noch im Bett liegend, dement und blind.
Jobberei, Ehe und ein neues Studium
Der Tod meiner Eltern war ein größerer Schlag für mich, als ich mir damals eingestehen wollte, und in gewisser Weise begann damit ein für mich dunkles – oder zumindest sehr schwieriges – Jahrzehnt. Ich konnte nicht richtig trauern, hatte zuerst keine Zeit, das Geschehene zu verarbeiten. Aber man kann vor so etwas nicht weglaufen. Es holte mich immer wieder ein. Diese psychische Belastung war sicherlich ein Grund, warum ich das Studium schließlich abbrach.
Es gab aber auch rein materielle Gründe. Nach dem Tod meines Vaters hatte ich einen Anspruch auf Knappschafts-Kinderrente, man könnte es auch Waisenrente nennen. Aber es dauerte mehr als ein halbes Jahr, bis deren Höhe errechnet wurde. Bis dahin musste ich regelmäßig beim Studentenwerk vorstellig werden, meine Lage erklären und um einen Vorschuss auf die erwarteten Zahlungen von der Knappschaft bitten. Ich bekam dann jedes Mal etwas Geld. (Das ich natürlich später zurückzahlte.) Das ging vielleicht zwei Monate so, dann hing es mir zum Hals raus, betteln zu müssen. Ich musste etwas finden, von dem ich leben konnte. Die Waisenrente – sie betrug am Ende knapp 125 Mark im Monat – reichte dafür nicht aus. Und so schmiss ich im sechsten Semester mein Studium und ging wieder zurück nach Recklinghausen, um mir Jobs zu suchen.
Die folgenden knapp drei Jahre sehe ich in der Rückschau wie durch einen Nebel. Ich arbeitete mal hier, mal dort – was man halt so machen kann, wenn man keine Ausbildung hat: Tiefbau, Hochbau, Handlanger auf Baustellen. Maloche, wie man im Ruhrgebiet sagt. Mal wohnte ich bei meiner Schwester – also wieder zurück in der Leusbergstraße, von der ich doch glaubte, ich hätte sie hinter mir gelassen, um im diplomatischen Korps durch die weite Welt zu reisen – und eine Zeit auch bei Tante Anni und Onkel Leo. Anders gesagt, ich war in die erste von zwei Lebenskrisen geschlittert, die dieses Jahrzehnt für mich bereithalten sollte.
Es half mir ganz ohne Frage, dass ich nicht alleine war. Wenige Monate vor dem Tod meiner Eltern hatte ich ein sehr hübsches, nettes Mädchen namens Ingrid kennengelernt. Ich war mit einem ehemaligen Klassenkameraden zum Silvesterball nach Herne gefahren, ins Café Central. Sie war auch dort, mit einer Freundin. Wir haben zusammen getanzt, und weil sie ebenfalls aus Recklinghausen Süd stammte, brachte ich sie später, in der Neujahrsnacht, nach Hause. Es entwickelte sich das, was manchmal aus solchen zufälligen Treffen entsteht. Knapp vier Jahre später heirateten wir.
Ingrid kam aus einem gutbürgerlichen Geschäftshaushalt, ihre Eltern hatten eine alteingeführte Lotto-Annahmestelle, in der man auch Tabakwaren und Zeitschriften kaufen konnte. Für jemanden von der Leusbergstraße war es schon ein kleiner sozialer Aufstieg, in eine Familie zu kommen, in der man sonntags an gedeckten Tischen saß und aus feinem Porzellan Kaffee trank. So etwas kannte ich gar nicht. Aber ich wurde herzlich aufgenommen, vor allem, als ich nach dem Tod meiner Eltern moralische Unterstützung benötigte.
Die Beziehung zwischen Ingrid und mir war erheblich turbulenter, als diese Worte es klingen lassen. Vor der Heirat waren wir verlobt, dann entlobt, dann wieder verlobt. Zum allergrößten Teil lag die Schuld bei mir. Ich war in jener Zeit nicht leicht zu nehmen und sicher auch sehr unreif. Vor allem aber, da bin ich mir heute sicher, war ich einfach mit mir und meinem Leben zutiefst unzufrieden. Mein Traum vom Botschafterposten an einem exotischen Ort war geplatzt, und ich hatte ihn nicht durch einen anderen ersetzt, sondern ließ mich nur treiben und war auf dem besten Weg zum Tunichtgut. Eine Zeit lang tingelte ich sogar durch Spielcasinos, verdingte mich als Croupier und fing selbst an zu zocken. Vielleicht hatte ich deswegen später, als Geschäftsführer einer Trabrennbahn, ein gutes Gespür für die Mentalität des zwanghaften Spielers.
Zum Glück hatte ich in jener Phase dann doch noch einen lichten Moment. Nach drei Jahren fühlte ich mich, als würde ich immer mit dem Schädel gegen eine Wand rennen. „Um Himmels willen, das kann doch nicht mein Leben sein!“, schoss es mir durch den Kopf. „Ich muss doch etwas machen, was einen Sinn hat.“ Naheliegend wäre gewesen, das alte Studium wieder aufzunehmen. Ich dachte auch kurz daran, stellte aber schnell fest, dass ich zu viel Abstand gewonnen hatte. Dieser ganze Juristenkram war mir fremd geworden. Außerdem hätte es bis zum Staatsexamen noch einige Zeit gedauert, und ich brauchte eine Ausbildung, die ich zügig abschließen konnte. Das soll man im Leben nie tun – etwas machen, nur weil es schnell geht. Aber diese Lektion hatte ich damals noch nicht gelernt.
Zu jener Zeit konnte man durch ein Studium von sechs Semestern Volksschullehrer werden. Zwei davon würde man mir erlassen, weil ich aus Münster und Berlin ein Vorstudium nachweisen konnte. Das hieß also: Ich konnte in nur zwei Jahren, nach vier Semestern, Lehrer werden. So begann im Jahr 1964 an der Pädagogischen Hochschule in Dortmund mein zweites Leben als Student.
Wovon aber sollte ich während der vier Semester leben? Die Lösung des Problems hätte meinem Vater vermutlich sehr gefallen. Sein Sohn, der nie auf den Pütt wollte, finanzierte sich sein Studium unter Tage, auf der Zeche General Blumenthal. Natürlich war ich nicht wie mein Vater im Streb, wo die Kohle abgebaut wird. Stattdessen wurde ich zwei alten Hauern im sogenannten Streckenvortrieb als Gehilfe zugeteilt. Es wurde in zwei Schichten gearbeitet. Die erste Schicht bohrte Löcher und sprengte; die zweite, das waren wir, legte Schienen und baute die Strecke aus. Zuvor mussten aber natürlich die Steinbrocken vom Sprengen aus dem Weg geräumt werden. Das war mein Job: Steine zum Abtransport in die Lore schaufeln. Harte Arbeit für zarte Studentenhändchen.
Eines Tages, während der Butterbrotpause, kam der Steiger zu mir. „So, Hansch“, sagte er. „Jetzt wollen wir uns mal einen Streb ansehen.“ Auf dem Arschleder rutschten wir in Schräglage runter auf die nächste Sohle. Und dort habe ich dann gesehen, unter welchen Bedingungen mein Vater 36 Jahre lang geschuftet hatte. Nicht erst seit diesem Tag habe ich Respekt und große Ehrfurcht vor der Arbeit der Kumpel.
Es ist schon seltsam: Obwohl ich mich als Junge mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hatte, auf den Pütt zu gehen, ist es mir heute sehr wichtig, dass ich dann doch noch dort gewesen bin, wenn es auch nur sechs Wochen in den Semesterferien waren. Viele Jahre später, Ende der 1990er, lernte ich den Vorstandsvorsitzenden der Ruhrknappschaft zufällig kennen, und wir unterhielten uns über die große Zeit der Zechen. Ich erwähnte, dass ich auch mal eine Zeit auf dem Pütt gearbeitet hatte, was ihn sehr interessierte. Etwa drei Wochen später bekam ich Post von ihm. Er hatte in alten Unterlagen gewühlt und tatsächlich meine Knappenkarte aus den 1960ern gefunden. Ich habe sie noch heute – und bin sehr stolz auf sie. Onkel Leo hat es leider nicht mehr erlebt, dass sein Ersatzsohn auf die Zeche ging. Ich war noch nicht lange wieder im Studium, da kam ich eines Tages nach Hause, in die Leusbergstraße, und fand Zita und Tante Anni tränenüberströmt vor.
Читать дальше