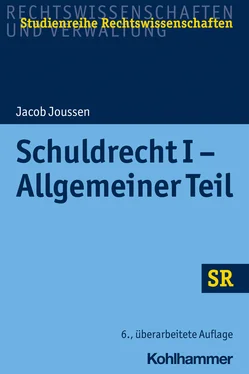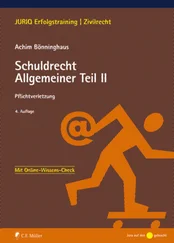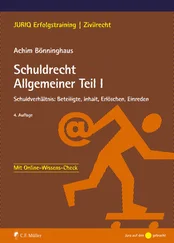56 (2) Übertragung des ganzen Vermögens.Neben der wichtigen Formvorschrift in § 311b Abs. 1 enthält diese Norm noch weitere Formvorschriften, deren Beachtung in bestimmten Fällen zur Wirksamkeit eines Vertrags erforderlich ist. Nach § 311b Abs. 2 ist jeder Vertrag, der auf eine Übertragung des künftigen Vermögens gerichtet ist, von vornherein nichtig. 79Demgegenüber kann das gesamte gegenwärtige Vermögen durchaus übertragen werden. Nach § 311b Abs. 3 ist dazu jedoch eine notarielle Beurkundung erforderlich. Verpflichtet sich hierzu jemand, soll er durch diese Formvorschrift besonders geschützt werden. 80Sie betrifft wie diejenige des Absatz 1 nur Verpflichtungsgeschäfte. Entscheidend ist jedoch, dass es hier um die Verpflichtung zur Übertragung des Vermögens als Ganzes geht. Sollen hingegen nur einzelne Gegenstände, seien es auch sehr viele, übertragen werden, ist die Beachtung einer besonderen Form nicht erforderlich, auch nicht hinsichtlich des Verpflichtungsgeschäfts. Das ist dadurch zu rechtfertigen, dass sich bei der Übertragung des Vermögens als Ganzes der Übertragende möglicherweise nicht klar darüber ist, was er im Einzelnen überträgt. Davor soll er geschützt werden. Überträgt er hingegen alle Gegenstände einzeln, weiß er um den Umfang des Verpflichtungsgeschäfts. Daher bedarf er hier nicht in gleichem Maße eines Schutzes. 81Anders als die Vorschrift über die Verpflichtung zur Übertragung eines Grundstücks enthält § 311b Abs. 3 keine Heilungsmöglichkeit.
57 (3) Übertragung des künftigen Erbes.§ 311b Abs. 5 enthält eine dritte Formvorschrift des Allgemeinen Schuldrechts. Nach dieser bedarf ein Vertrag, der unter künftigen gesetzlichen Erbenüber den gesetzlichen Erbteil oder den Pflichtteil eines von ihnen geschlossen wird, der notariellen Beurkundung. In Abgrenzung zu dem Vertrag, der über den Nachlass eines noch lebenden Dritten abgeschlossen wird und der nach § 311b Abs. 4 nichtig ist, ist also ein solcher Vertrag über den gesetzlichen Erbteil oder Pflichtteil durchaus statthaft. Aus Schutzgründen vor Übereilung ist jedoch hier erneut die besondere Formvorschrift vorgesehen. 82
58Wenn auch grundsätzlich im BGB die Vertragsfreiheit eine alles überragende Bedeutung einnimmt und somit die vertragliche Einigung im Zentrum jeder Entstehung eines Schuldverhältnisses steht, gibt es doch ausnahmsweise Situationen, in denen ein Vertrag nicht auf einer freiwilligen Willensentschließung der Parteien beruht, sondern zwingend vorgeschrieben ist. Man spricht dann von einem Kontrahierungszwang, der wiederum von sog. „diktierten Verträgen“abzugrenzen ist. Neben dieser sehr weit reichenden Einschränkung der Vertragsfreiheit gibt es weitere Bereiche, in denen die Parteien nicht völlig frei in ihrer Entscheidung sind, wie sie einen Vertrag gestalten möchten. Solche Einschränkungen, zu denen auch die bereits angesprochenen §§ 134 und 138 gehören 83, finden sich vor allem bei Verträgen, an denen Verbraucher beteiligt sind. Hier geht es um allgemeine Grenzen der Vertragsfreiheit zugunsten der Verbraucher, zudem greifen Einschränkungen immer dann, wenn eine Vertragspartei „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ verwendet.
59 a) Der Kontrahierungszwang.Fälle eines echten Kontrahierungszwangsgibt es nur außerordentlich selten. Gemeint sind die Situationen, in denen die Abschlussfreiheit als besondere Erscheinungsform der Vertragsfreiheit, im Sinne einer Entscheidung darüber, ob überhaupt ein Vertrag mit einer anderen Partei abgeschlossen werden soll, ausgeschlossen ist. Ein derartiger Ausschluss der Vertragsfreiheit in Form der Abschlussfreiheit kann auf einer besonderen gesetzlichen Regelung beruhen. Denkbar ist darüber hinaus, dass allgemeine Rechtsvorstellungen bzw. Rechtsvorschriften eine Kontrahierung zwingend erfordern.
60Der Kontrahierungszwang, der gesetzlich durch eine besondere Regelung vorgesehen ist, dient in erster Linie dazu, ein öffentliches Interesse, das an einem Vertragsschluss besteht, abzusichern und zu garantieren, dass überhaupt ein freier Wettbewerb stattfinden kann. 84Es geht im Regelfall um bestimmte Massengeschäfteim öffentlichen Bereich, in denen der einzelne Bürger eine Garantie dafür erhalten soll, dass er von einem ihm gegenüberstehenden Anbieter in ein Vertragsverhältnis hinein genommen wird. So enthält etwa § 17 Abs. 1 EnWG die Verpflichtung aller Energieversorgungsunternehmen, jedermann zu den allgemeinen Bedingungen an das Versorgungsnetz anzuschließen und zu versorgen. Gleiches gilt für diejenigen Unternehmen, die entgeltlich oder geschäftsmäßig die Beförderung von Personen übernehmen, wie dies in § 1 PBefG geregelt ist. Erfasst sind also insbesondere die Beförderungsunternehmen der Straßenbahnen, Busse und Taxis. Hier ist in § 22 PBefG unter bestimmten Voraussetzungen eine Pflicht der Unternehmen begründet. Der Beförderungsunternehmer hat keine Auswahl, mit wem er einen Vertrag abschließt, er ist vielmehr zum Vertragsschluss gesetzlich verpflichtet. Das Gleiche gilt für die Haftpflichtversicherungen, die nach § 5 Abs. 2 PflVG dazu gezwungen sind, jedem Kraftfahrzeughalter Versicherungsschutz zu gewähren. 85
61Auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründenkann es ausnahmsweise zu einem Kontrahierungszwang kommen. Hierzu ist ein Rückgriff z. B. auf § 19 Abs. 1 GWB (Art. 102 AEUV) erforderlich, der den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung von Unternehmen sanktioniert. 86
62Gelegentlich wird darüber hinaus ein allgemeiner Kontrahierungszwangbejaht, auch ohne dass eine wettbewerbsrechtliche oder sonstige gesetzliche Regelung vorliegt. In diesen Fällen kann man vor allem auf § 826 oder, im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, auf das Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG zurückgreifen. Ein Kontrahierungszwang kann sich insofern aus einer „Gesamtanalogie“ zu den gesetzlichen Vorschriften über den Kontrahierungszwang ergeben. 87Gemeint sind in diesen seltenen Fällen Situationen, in denen es um den Zugang zu besonderen im öffentlichen Raum stattfindenden Veranstaltungen etwa aus dem kulturellen oder sportlichen Bereich geht. 88Ob allerdings tatsächlich ein großer Sportverein dazu verpflichtet ist, jedermann Zutritt zu seinen Fußballspielen zu gestatten, ist unverändert umstritten, denn zum Teil wird vertreten, die Rechtsgrundlagen für einen solch weitgehenden Eingriff in die Vertragsfreiheit hin zu einem konkreten Kontrahierungszwang seien zu unbestimmt. 89
63Jedenfalls kann ein allgemeiner Kontrahierungszwangnach genereller Auffassung in ganz besonderen Fällen auf § 826 gestützt werden. Die nach dieser Vorschrift erforderliche sittenwidrige Schädigungsieht man darin, dass jemand einen Vertragsschluss vorsätzlich ablehnt, obwohl er dazu nach der Rechtsvorstellung aller billig und gerecht Denkenden verpflichtet wäre. 90Denkbar ist dies etwa, sofern es um solche Güter bzw. Leistungen geht, die für denjenigen, der den Vertrag erstrebt, von überaus großer Bedeutung sind. 91Es muss jedoch um wirkliche Ausnahmefälle gehen, denn ansonsten würde das Prinzip der Vertragsfreiheit zu stark eingeengt. Daher wird zu Recht überwiegend abgelehnt, dass ein Kontrahierungszwang für eine Spielbank oder für Lebensmittelgeschäfte besteht. 92
64 b) Der „diktierte Vertrag“.Vom Abschluss- oder Kontrahierungszwang unterschieden wird schließlich regelmäßig der sog. „diktierte Vertrag“. Bei ihm ist entscheidend, dass die Parteien nicht mehr von sich aus die Willenserklärung abgeben müssen, wie dies noch beim Kontrahierungszwang der Fall ist. Es bedarf keines technischen Vertragsschlusses durch die Parteien mehr. Der Vertrag kommt vielmehr unmittelbar durch den entscheidenden, festsetzenden Akt des Dritten zustande.
Читать дальше