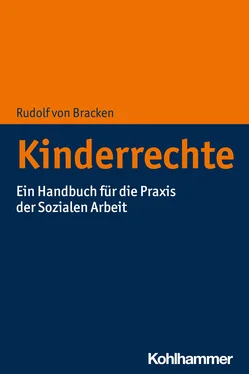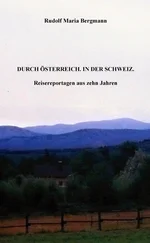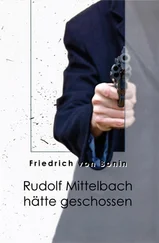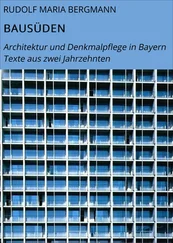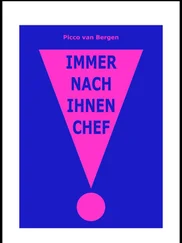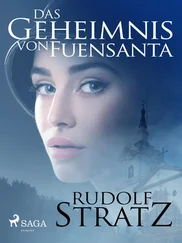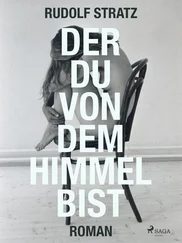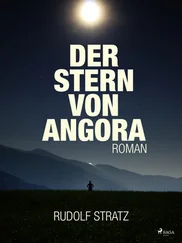(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
Das ist die inhaltliche Rangordnung, es geht um das »Menschenbild des Grundgesetzes« von der Menschenwürde. Die wird in ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes dahin für verbindlich erklärt, dass niemand reines Objekt staatlichen Handelns sein darf (Objekt synonym verstanden zu einer »Sache«).
2. Sodann haben wir die Zuordnung der großen staatlichen Gewalten untereinander:
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Neben dem Grundprinzip der Demokratie (»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«) und der Benennung der drei Gewalten erfolgt die Zuordnung untereinander im Abs. 3: Die Gesetze sind an das Verfassungsrecht gebunden und müssen ihm entsprechen, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung binden sich an Gesetz und Recht.
Das Widerstandsrecht ist sozusagen die Notwehr des Volkes, damit ist betont, dass jenseits aller staatlichen Gewalt auch das Volk doch noch irgendwie ein letztes Wort und gegenüber der Abschaffung des Grundgesetzes eine Art Notwehrrecht hat.
Die jeweiligen Vorschriften auf Verfassungsebene werden Artikel (Art.) genannt, die Gesetze sind Paragrafen (§), die Verordnungen sind staatliche Befehle, die unterhalb der gesetzlichen Ebene und in Ausführung und näherer Bestimmung von gesetzlichen Grundsätzen dem Bürger gegenüber in Verwaltungsakten und ansonsten zur internen Regelung innerhalb der Verwaltung Bestimmungen treffen.
Beispiele für Verwaltungsakte: Bescheide der Baugenehmigung. Beispiele für Verwaltungsanordnungen: Erlasse und Verfügungen im Bereich der Finanzverwaltung bei der Erhebung von Steuern.
1. Jede rechtliche Regelung besteht aus Tatbestand und Rechtsfolge. Im Tatbestand wird ein bestimmter realer Lebenssachverhalt, insbesondere ein Geschehen, eine Tatbegehung, erfasst. Ihn gilt es zu erkennen und der Norm, der gesetzlichen Regelung zuzuordnen. Im Strafrecht ist das etwa im Beispiel der Körperverletzung die Zufügung eines körperlichen Übels (»Verletzung«), die bei dem Vorliegen der weiteren Strafbarkeitsvoraussetzungen Vorsatz und Schuld dann zu der Strafbarkeit führt. Ein Gericht (dem dies nach dem Grundgesetz vorbehalten ist) verhängt auf eine Anklage der Staatsanwaltschaft die der Schuld angemessene Strafe.
Hier ist der Bereich, in dem sich die gesamte dritte Gewalt abspielt. Denn das Erkennen von Sachverhalten und die Ableitung von bestimmten Folgerungen entsprechend dem Gesetz ist Sache der dritten Gewalt, der Rechtsprechung. Bei der Anwendung von »Recht« kann man bekanntlich verschiedener Meinung sein, es gibt Wahrnehmungen, Interessen, Konflikte und bewusste oder unbewusste Werte und Grundeinstellungen, die jeweils andere Ergebnisse bringen können. Durch die Zuweisung der entsprechenden Aufgabe im staatlichen Bereich der Rechtsprechung und dort der Gerichte und deren Zuständigkeitsregelungen wird bestimmt, wer dann als Gericht (Richterin, Richter, Kammer, Senat als »Spruchkörper«) das Richtige und Verbindliche feststellt.
2. Bei der Rechtswirklichkeit spielt eine ganz große, eben die alltägliche Rolle die sogenannte Verwaltungspraxis, intern vielleicht bestimmt auch durch Verwaltungsanordnungen, Ausführungsbestimmungen etc., die für alle davon Betroffenen im Idealfall das wichtige Kriterium der Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit erfüllen. Ein »Gewohnheitsrecht« ist in diesem Zusammenhang allerdings kein Rechtsbegriff, welcher juristische Bedeutung hat. Allenfalls handelt es sich um die Bezeichnung von »Erwartbarem« in Kenntnis einer Verwaltungspraxis oder der gerne so genannten »ständigen Rechtsprechung«, rechtlich legitimiert wäre das aber nur durch eine korrekte Rechtsanwendung und Rechtspraxis, die also dem Gesetz entspricht und im Streitfall auch gerichtlich bestätigt würde.
3. Die Auslegungskriterien sind der Wortlaut und der Zweck der Norm. Wir haben also zum einen den festen Rahmen der wörtlichen Bedeutung, mehr oder weniger erleichtert durch sprachlich präzise Formulierungen des Normgebers (wo es allerdings große Unterschiede in Verständlichkeit gibt, abhängig auch von der Kompliziertheit der Materie). Grundsätzlich gilt, dass man sich auf die wirkliche Bedeutung stützt und mit dieser wörtlichen Auslegung der Norm das beste Argument hat.
Im Rahmen möglicher Auslegungen des Wortlauts kommt dann der sogenannte »Gesetzeszweck«, also der Sinn der Norm, in die Betrachtung. Das ist das, was »der Gesetzgeber« gemeint hat und erreichen wollte. Es ergibt sich möglicherweise aus dem Zusammenhang, aus der Gesamtheit der gesetzlichen Regelungen in diesem Bereich, also auch der benachbarten Normen, die parallele oder angrenzende Sachverhalte regeln. Die Gerichte, jedenfalls die Obergerichte, insbesondere die Bundesgerichte und das Bundesverfassungsgericht, greifen darüber hinaus bei Streitfragen auf die sogenannten »Gesetzesmaterialien« zurück. Das sind die protokollierten Diskussionen auf der Gesetzgebungsebene, regelmäßig in den Drucksachen des Bundestages und des Bundesrates öffentlich zugänglich.
3 Beispiele Unterhalt, Verwandtschaft
1. Die Unterhaltsnormen von § 1601 und § 1603 BGB für Kindesunterhalt sind ein Beispiel für familienrechtlich relevante und die materiellen Verhältnisse bestimmenden Gesetze.
§ 1601 BGB Unterhaltsverpflichtete
Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.
§ 1603 BGB Leistungsfähigkeit
(1) Unterhaltspflichtig ist nicht, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren.
(2) Befinden sich Eltern in dieser Lage, so sind sie ihren minderjährigen unverheirateten Kindern gegenüber verpflichtet, alle verfügbaren Mittel zu ihrem und der Kinder Unterhalt gleichmäßig zu verwenden. Den minderjährigen unverheirateten Kindern stehen volljährige unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs gleich, solange sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden. Diese Verpflichtung tritt nicht ein, wenn ein anderer unterhaltspflichtiger Verwandter vorhanden ist; sie tritt auch nicht ein gegenüber einem Kind, dessen Unterhalt aus dem Stamme seines Vermögens bestritten werden kann.
2. Es handelt sich um Grundregeln, die das Gesetz hergibt. Die Subsumtion, also die Anwendung auf den Einzelfall mit dem Ziel der Ermittlung einer konkreten Zahl oder eines Wertes, ist jedoch im Unterhaltsrecht generell den Gerichten überwiesen. Es handelt sich hier um reines Fallrecht, eine hier richtigerweise besonders um Vorhersehbarkeit und transparente Grundprinzipien bemühte Rechtsprechung.
Unterhaltspflicht setzt die Bedürftigkeit des Anspruchstellers (»Bedürftigen«) und die Leistungsfähigkeit des Antragsgegners (»Verpflichteten«) voraus. Hier ist es der Kindesunterhalt.
Читать дальше