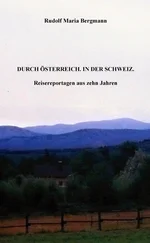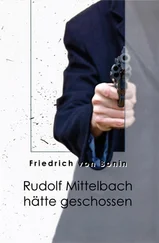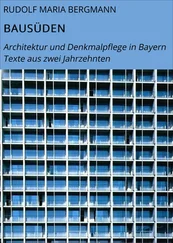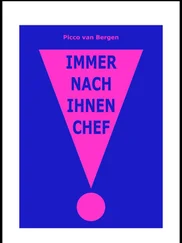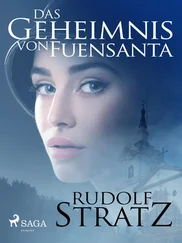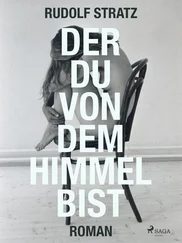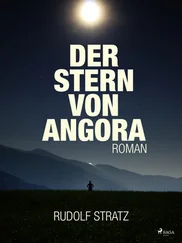3. Zur Durchsetzung von Besuchsregelungen (Umgang des Kindes mit einem Elternteil, von dem es getrennt lebt) sieht das Gesetz jedoch ein absolutes Gewaltverbot vor, zur Durchsetzung von Umgang darf auch kein Gericht Gewalt gegen ein Kind erlauben/anordnen (§ 90 Abs. 2 Satz 1 FamFG). Ansonsten kann und darf gerichtliche Gewaltermächtigung nur unter strenger Prüfung der Verhältnismäßigkeit und der unbedingten Erforderlichkeit zur Sicherung des Kindeswohls erfolgen (Satz 2).
 Zwei Rechtsgründe, etwas tun oder lassen zu müssen
Zwei Rechtsgründe, etwas tun oder lassen zu müssen
 Personen im Sinne des Rechts, Rechtssubjekte
Personen im Sinne des Rechts, Rechtssubjekte
 Gewaltverbot, Gewaltmonopol
Gewaltverbot, Gewaltmonopol
 Mächtige Staatsorgane
Mächtige Staatsorgane
 Gerichtliche Kontrolle, Richtervorbehalt
Gerichtliche Kontrolle, Richtervorbehalt
 Gewaltenteilung, kontrollierte Staatsgewalt horizontal
Gewaltenteilung, kontrollierte Staatsgewalt horizontal
 Gewaltenbeschränkung, kontrollierte Staatsgewalt vertikal
Gewaltenbeschränkung, kontrollierte Staatsgewalt vertikal
II
Rechtsgarantien und ihr Schutz
1 Wie sich wehren?
1.1 Abgrenzung und Schutz der absolut geschützten Persönlichkeits- und Privatsphäre
Die persönliche Freiheit eines jeden Menschen schützt Art. 2 GG, das ist neben der freien Entfaltung der Persönlichkeit auch und gerade der Kernbereich des Persönlichkeitsrechts, die Privatsphäre.
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Die Strafgesetze und auch das Familienrecht (§ 1631 b BGB, Geschlossene Unterbringung) und das Jugendhilferecht (§ 42 SGB VIII, Inobhutnahme) sind solche Gesetze, ebenso die Polizeigesetze von Bund und Ländern (Gefahrenabwehr, Strafverfolgung).
1.2 Beispiel Hausrecht
Art. 13 GG
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.
(3) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.
Die strafrechtliche Gewährleistung der Unverletzlichkeit der Wohnung findet sich in § 123 StGB.
§ 123 StGB Hausfriedensbruch
(1) Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
Hier ist genau nachzuvollziehen, wie im konkreten Einzelfall die Reichweite eines Grundrechts nach Zentimetern genau bemessen ist. Jede Wohnung hat eine definierte Fläche von Quadratmetern und Quadratzentimetern, die so auch strafrechtlich geschützt ist. Wer »widerrechtlich eindringt«, also sich hineinbegibt ohne Einverständnis, macht sich genauso strafbar wie derjenige, der »ohne Befugnis darin verweilt« und »auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt«.
In diese Privatsphäre kann aufgrund des Freiheitsvorbehaltes (Unverletzlichkeit, Freiheit der Person und des Kernbereichs der Persönlichkeit in der Privatsphäre, Art. 2 Abs. 2 GG) nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das Gesetz regelt den Eingriff und knüpft ihn an die Richterentscheidung (Richtervorbehalt).
1. Die Polizei kann gerufen werden, wenn die nicht berechtigte Person gegen die Aufforderung des Verlassens einfach bleibt. Mag die Polizei auch einschätzen, dass das nicht so gefährlich ist, also die Gefahrenlage mit notwendigem polizeilichen Handeln verneinen, muss sie doch einschreiten zur Strafverfolgung, weil eine Straftat vorliegt. Eine weitere Grundrechts-Erwehrung sind die Möglichkeiten der Selbsthilfe gegen verbotene Eigenmacht (§ 858, § 859 BGB, Selbsthilfe des Besitzers bei Besitzstörung): Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. Das wäre ein Hinausschieben oder auch ein Hinausstoßen.
Selbst wenn damit eine Körperverletzung einhergehen würde (Anstoßen gegen Türrahmen, blauer Fleck, Schürfung) wäre dies nicht strafbar, weil mit der ausdrücklichen gesetzlichen Erlaubnis die Tat nicht rechtswidrig wäre.
2. Notwehr und Nothilfe: Zur Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs von sich (Notwehr) oder von einem anderen (Nothilfe) kann eine – auch schwere – Straftat geschehen, ohne dass diese strafgerichtlich verurteilt werden kann. Denn diese Handlung ist nicht rechtswidrig (§ 32 StGB).
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.
Davon erfasst wird aber nur die Verteidigung, die insoweit notwendig zur Abwehr des Angriffs ist. Sofern die Grenzen der Notwehr aber »aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken« überschritten werden, bleibt es aus diesem Grund straflos (Putativnotwehr).
§ 33 StGB Überschreitung der Notwehr
Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft.
3 Handlungs- und Bewegungsfreiheit und Privatsphäre
1. Die äußere Freiheit der Person, also die Bewegungsfreiheit, unterliegt ebenso ausdrücklich gemäß Art. 104 Abs. 2 GG der richterlichen Entscheidung, und nur ihr.
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden.
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.
(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.
Читать дальше
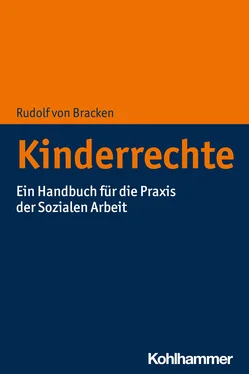
 Zwei Rechtsgründe, etwas tun oder lassen zu müssen
Zwei Rechtsgründe, etwas tun oder lassen zu müssen