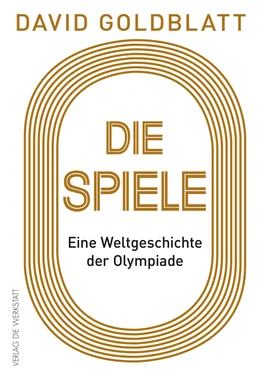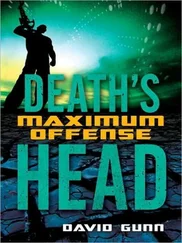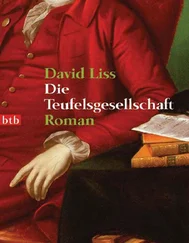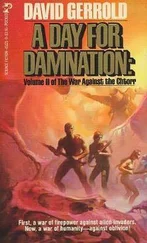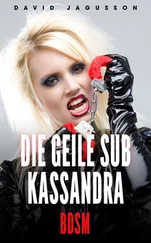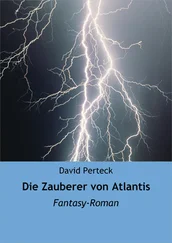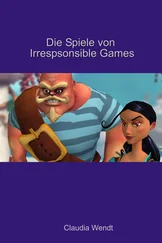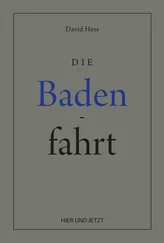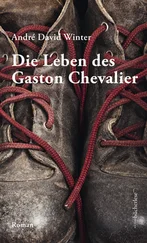In der umfangreichen Berichterstattung der britischen Presse zu Sinn und Zweck der Spiele ließen sich drei verschiedene Denkrichtungen feststellen. Zum einen gab es, wenn auch erstaunlich verhalten, den freimütigen, optimistischen, internationalen Olympismus. Lord Desborough erklärte im Vorfeld der Spiele im Gespräch mit der Daily News : »Die zugrunde liegende Hoffnung ist, dass die Jugend, und vor allem die sportlich gesinnte Jugend, der unterschiedlichen vertretenen Nationen, indem sie sich in freundschaftlicher Rivalität begegnen, einander besser kennen- und schätzen lernen. Vielleicht sogar wird das Wohlwollen zwischen den Nationen – das Wohlwollen, das dazu beiträgt, den Ausbruch eines Krieges zu verhindern – durch diese Olympischen Spiele mindestens ebenso sehr gefördert wie von Diploma-ten, die an einem am runden Tisch sitzen.« 2
Der Evening Standard befand hingegen, dass das geopolitische Potenzial der Spiele nicht in einem Beitrag zum Frieden läge, sondern in der symbolischen Etablierung Britanniens an seinem rechtmäßigen Platz als globaler Hegemonialmacht und Urheber universeller Regeln, inklusive Sportregeln, die vom Rest der Welt ganz selbstverständlich anerkannt würden. Die Zeitung argumentierte weiterhin, dass es nicht darum ginge, wie viele Medaillen das Empire gewänne, sondern um die Größenordnung der Schau und den Willen zur Führerschaft, auf den die Besucherzahlen bei den Spielen verweisen würden:
England hat in vielen Sportarten die Richtung vorgegeben. Die Spiele, die seine Söhne als erste spielten oder mit Regeln und Vorschriften zur Ordnung brachten, sind von vielen Nationen übernommen worden. Es stellt die Regeln auf in der vollen Gewissheit, dass ihnen gehorcht wird ohne das Zutun von Schlachtschiffen und Maschinengewehren. Die Stellung, die England in der Welt des Sports einnimmt, wird bleibenden Schaden nehmen, sollten die Spiele von 1908 denen, die ihnen vorausgingen, nicht nur ebenbürtig sein an Ausmaß und Resonanz, sondern diese nicht sogar so weit übertreffen, dass daraus eine erhebliche Zunahme der Begeisterung für solche internationalen Zusammenkünfte entsteht. 3
Der Bystander nahm ironisch eine dritte Haltung zu den Spielen aufs Korn: die Angst, dass die Vorherrschaft des britischen Imperiums nicht mehr gesichert war und dass das körperliche und sportliche Auftreten der Nation sowohl Ursache als auch Wirkung dieses Niedergangs sei. Es war erst wenige Jahre her, dass die britische Armee, auf dem Höhepunkt des Zweiten Burenkriegs, erkennen musste, dass die große Mehrheit ihrer Rekruten aus der Arbeiterklasse bei so schlechter Gesundheit war, dass sie für den aktiven Dienst nicht infrage kam. Wer einen üppigen Medaillenregen für die Gastgeber erwartete, würde ein böses Erwachen erleben:
Oh Britisches Empire, groß und frei.
Der Moment ist magisch, kommt herbei!
Wie einst Rom werden wir vergehen,
Falls wir im Hochsprung leer ausgehen.
Unser Stern, einst hell, wird sich bald senken
Sollten wir – nicht auszudenken! –
Im Sprint nicht unser Können zeigen
Und über die Hürden es vergeigen. 4
Rückblickend betrachtet näherten sich die europäischen Großmächte ohnehin ihrem Ende. Zehn Jahre später, am Ende des Ersten Weltkriegs, lag das deutsche, russische, österreichischungarische und osmanische Reich in Trümmern, ein weiteres Vierteljahrhundert und einen zweiten Weltkrieg später dann auch das britische, französische, niederländische und belgische. Die Zukunft gehörte Nationen und Nationalstaaten. Die Eröffnungszeremonie nahm sich die in Athen 1906 zum Vorbild und trug diesem Umstand Rechnung mit einer großen Parade der Nationen vor König Edward VII. und einer Reihe europäischer Monarchen und Kronprinzen. Während der Spiele berichtete die Presse, dass es »nicht die Namen der einzelnen Athleten waren, die ihre Landsleute riefen, sondern der ihrer Nation, so wie die Namen von Sparta und Athen über die Ebene von Olympia hallten«. 5
Vor allem die Amerikaner machten sich Gedanken, wie die olympische Gesamtmeisterschaft zwischen den Nationen entschieden würde und wie viele Punkte jede Nation für einen ersten, zweiten oder dritten Platz erhalten sollte. James Sullivan, Delegationsleiter des USTeams in London, entwickelte sein eigenes System. Der San Francisco Chronicle verstieg sich zu der Behauptung, dass die Briten ein perfides Zählsystem ausheckten, das ihre Athleten bevorzuge und ihnen die Meisterschaft sichern würde. Tatsächlich existierte kein solches System – jedenfalls keines, das jemals offiziell gutgeheißen wurde; die ganze Sache war ein Hirngespinst der Presse, mit aktiver Unterstützung des sportlichen Establishments.
Wie Theodore Cook jedoch im offiziellen Bericht von 1908 sinnierte, beschäftigte die Briten eine ganz andere Frage »von nicht geringer Schwierigkeit«: Mal ganz abgesehen davon, wie viele Punkte ein Land sammelte, was war überhaupt ein »Land«? Die Organisatoren richteten sich nach der 1906 vom IOC festgeschriebenen Definition: Laut dieser war ein Land oder eine Nation »jedes Territorium mit eigenständiger Repräsentanz im Internationalen Olympischen Komitee oder, wo eine solche Repräsentanz nicht vorliegt, jedwedes Territorium unter einer souveränen Jurisdiktion«. 6Die zweite Hälfte dieser Regelung ließ sich problemlos auf eindeutig unabhängige Nationalstaaten anwenden, aber die erste Hälfte ließ einen gewissen Interpretationsspielraum für Territorien, Nationen und Identitäten, die keine nationale Unabhängigkeit erlangt und, ganz wichtig, einen Fürsprecher im IOC hatten.
Dadurch konnte sowohl 1906 als auch 1908 eine böhmische Mannschaft am Einmarsch der Nationen teilnehmen, obwohl Böhmen eine mehrheitlich tschechischsprachige Provinz des Österreichisch-Ungarischen Kaiserreichs war, wenn auch eine mit einer lange erloschenen Monarchie und semi-autonomem Parlament. Im Universum des IOC aber machte Jiří Guth-Jarkovskýs Mitgliedschaft im Komitee es zu einem zulässigen, eigenständigen Territorium. Gleichzeitig war auch das Kaiserreich selbst in olympischer Hinsicht gespalten: in eine österreichische und eine ungarische Mannschaft. Damit spiegelte es den heiklen konstitutionellen Kompromiss von 1867 wider, der beiden Kronen gleichberechtigten Status in einem einzelnen, zentralisierten Kaiserreich zusicherte.
Der Auftritt des Britischen Empires erwies sich 1908 als ebenso komplex, mit eigenständigen Mannschaften und Flaggen für Südafrika, Kanada, Australasien und Großbritannien. Südafrika war damals indes nicht mehr als eine geografische Bezeichnung, die politisch vier eigenständige Kolonien umfasste und denen man eine provisorische und in aller Eile ersonnene Fahne zuweisen musste – einen roten Banner mit einem Springbock. Kanada, eine Konföderation mehrerer Kolonien, gab sich daheim durchaus den Anschein eines Nationalstaats, war nach außen hin aber nur ein Dominion, dessen Außenpolitik und Militär von London aus kontrolliert wurden. Australasien bestand aus Australien, das 1901 als Föderation zuvor eigenständiger Kolonien entstanden war, plus Neuseeland, das 1907 den Status eines Dominions erhalten hatte.
Großbritannien hätte vielleicht als Nation aufgefasst werden können, aber als Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland umfasste es eine beträchtliche Bevölkerungsgruppe, die nur äußerst widerwillig unter britischer Fahne mitmarschierte. Tom Kiely, der 1904 im Zehnkampf gewann, wird offiziell als Mitglied der britischen Mannschaft geführt, aber als überzeugter irischer Nationalist lehnte er diese Vorstellung rundweg ab und sah sich selbst als unabhängigen bzw. irischen Teilnehmer. 1906 in Athen gewann Peter O’Connor die Goldmedaille im Dreisprung und Silber im Weitsprung. Er war unter der Ägide der Gaelic Athletic Association geschickt worden, doch die Organisatoren weigerten sich, diese als Nationales Olympisches Komitee anzuerkennen, so dass O’Connor mit zwei weiteren irischen Athleten in das britische Team versetzt wurde. Aus Protest feierte er seinen Sieg, indem er, während sein Kollege Con Leahy Schmiere stand, im Stadion einen Fahnenmast erklomm und eine irische Trikolore hisste.
Читать дальше