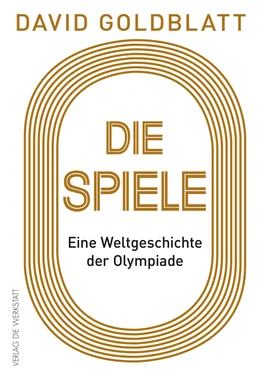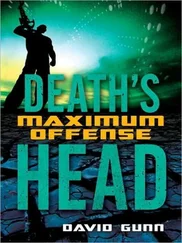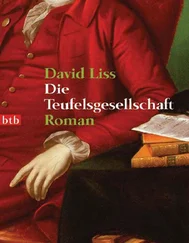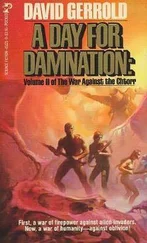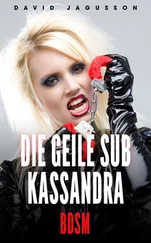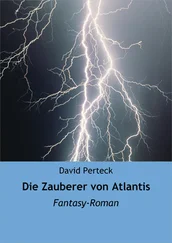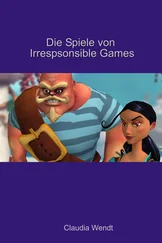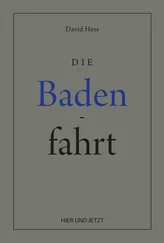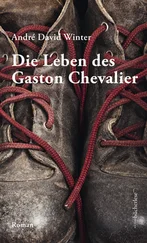Paradoxerweise waren es gerade diese Spiele, die Coubertins Vision am ehesten entsprachen. Sie waren gut und von Angehörigen der richtigen Kreise organisiert, boten ein schlankes und doch vielseitiges Sportprogramm innerhalb eines knappen, dichten Zeitplans, konzentrierten sich auf ein einziges, herrliches Stadion und waren bar jeglichen ideologischen Ballasts und ohne den ordinären, kommerziellen Rummel der Weltausstellungen. Sie versammelten mehr Athleten als Athen 1896 und St. Louis 1904 zusammen, und die meisten waren tadelloser Herkunft. Darüber hinaus verlieh die Eröffnungszeremonie der Veranstaltung den feierlichen Ernst, den Coubertin bei den vorigen Spielen so sehr vermisst hatte. Sowohl die griechische als auch die britische Königsfamilie waren vor Ort, und zum ersten Mal gab es einen Einmarsch der Nationen zu bewundern, bei dem die 900 Teilnehmer hinter Namensschildern und Fahnen ins Stadion einliefen.
Es blieb abzuwarten, ob London 1908, das wie seine beiden Vorgänger an riesige Ausstellungen gebunden war, die Spiele aus der Randständigkeit und Bedeutungslosigkeit retten könnte, unter denen sie in Paris und St. Louis gelitten hatten. Dies gelang aus vier Gründen, die alle miteinander verbunden waren. Erstens war die Franco-British Imperial Exhibition von 1908 deutlich weniger ideologisch ausgerichtet und überfrachtet als die Exposition Universelle und das Louisiana Purchase Centennial, die ganz im Zeichen des Triumphs von Wissenschaft und Fortschritt gestanden hatten und von zahllosen wissenschaftlichen Konferenzen begleitet worden waren. London 1908 bot weder großartige intellektuelle Zusammenkünfte, noch hatte es solche hochfliegenden, universalistischen Ansprüche. Es war eine alles in allem viel gemütlichere und süßlichere Feier dessen, was praktisch gesehen erreicht worden war. Infolgedessen gestand die Franco-British Exhibition den Spielen in kultureller wie räumlicher Hinsicht wesentlich mehr Platz zu als ihre Vorgänger.
Zweitens, sieht man von Auswüchsen rassistischer Anthropologie ab, waren die Spiele von 1900 und 1904 nicht von den größeren politischen oder kulturellen Fragen ihrer Zeit berührt worden. 1908 hingegen traten im Rahmen der Spiele britisch-imperiale Ängste zutage, die sich vor allem im Streit zwischen den britischen und amerikanischen Mannschaften äußerten. Darin spiegelten sich die wirtschaftlichen und politischen Konflikte zwischen dem herrschenden Empire und der aufstrebenden Macht. Drittens etablierten die Spiele von London – durch den Einmarsch der Nationen bei der Eröffnungsfeier sowie die Art und Weise, wie die Spiele verfolgt wurden – die nationale Dimension dieser nominell internationalen Spiele; wobei die Frage, was eine Nation ausmachte und wer sie bildete, noch nicht beantwort worden war. Und viertens sorgte der Marathon, ebenso wie 1896, für ein sportliches Spektakel von solcher Wucht, dass die Spiele im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit verankert wurden.
Die wichtigste Figur für die Durchführung der Spiele in London war weder Coubertin noch der Vorsitzende des Organisationskomitees, Lord Desborough, sondern Imre Kiralfy. Geboren 1845 in Budapest als Imre Konigsbaum, gingen er und sein Bruder mit einer ungemein erfolgreichen ungarischen Volkstanztruppe auf Tournee; später organisierten sie Festivals und Volksfeste in Brüssel, bevor sie sich dem Vaudeville und Amerika zuwandten, wo sich ihre Shows durch Extravaganz und langbeinige Revuetänzerinnen einen Namen mach-ten. 1887 tat sich Imre mit dem berühmten Zirkusdirektor P. T. Barnum zusammen und erregte Aufsehen mit spektakulären Bühnenversionen von Around the World in Eighty Days, The Fall of Babylon und Nero: The Burning of Rome . Anschließend ging er nach London, wo man ihm die Leitung des Veranstaltungsgeländes Earls Court im Londoner Westen übertrug, das zwar recht groß, für Kiralfys Ambitionen aber bei Weitem nicht geräumig genug war. 1904 schlossen die Regierungen von Frankreich und Großbritannien eine Reihe komplexer Abkommen über koloniale Herrschaftsbereiche ab, die Entente cordiale, und läuteten damit eine neue Ära diplomatischer und militärischer Zusammenarbeit ein. Im Zuge dessen gab es u.a. seitens der französischen Handelskammer eifrige Bestrebungen, eine gemeinsame Ausstellung auf die Beine zu stellen, und Kiralfy war genau der richtige Mann dafür.
Er versicherte sich der Unterstützung von Krone und Regierung, pachtete ein riesiges Areal alten industriellen Brachlands im Westen von London nahe Shepherd’s Bush, gewann die Rothschilds als Investoren und begann Anfang 1907 damit, Aufbauten zu errichten und neue Gleise und Stationen zu bauen. Als Lord Desborough und die British Olympic Association, die die Spiele angenommen hatten, ohne so recht zu wissen, wo sie eigentlich stattfinden sollten, an ihn herantraten, bot Kiralfy ihnen einen Deal an: Er würde ihnen ein dem Anlass angemessenes Stadion bauen, dafür aber drei Viertel der Eintrittsgelder einstreichen. Als Dreingabe bot er ihnen noch einen Vorschuss, den das ebenso aristokratische wie knauserige Komitee auch dringend brauchte. Sie waren natürlich einverstanden.
Im Laufe der fast sechs Monate, die es geöffnet war, strömten 8,4 Millionen Besucher auf das Messegelände der Franco-British Imperial Exhibition, das jedermann als White City bekannt war. Inspiriert durch den gleichnamigen Bau der Chicagoer Weltausstellung von 1893, war die Ausstellung architektonisch verspielter und heiterer als ihr Vorläufer. Mit ihren vielen Schnörkeln und Verzierungen und einer Skyline aus Kuppeln und Zinnen, Rotunden und Rondellen, Spitzen und Glockentürmen war sie viel mehr Lustgarten als Industrieausstellung. In einem einzigen Gebäude konnte man Elemente entdecken, die von arabischer, gotischer und fernöstlicher Architektur beeinflusst waren. Dorische Säulen standen neben arabischen Minaretten, siamesische Balkone hingen über seichten Teichen, ein Labyrinth schattiger Arkaden und kunstvoll angelegter Pfade führte Besucher in nur wenigen Schritten durch die Universitäten von Oxford und Cambridge, Haussmanns Paris, vorbei am Taj Mahal und dem Gare du Nord.
Doch das Herz der White City bildeten die volkstümlichen Vergnügungen: nächtliches Promenieren im Licht von tausend matten elektrischen Lampen; Schwanenboote, die über den künstlichen See im Court of Honour glitten, und das Flip-Flap, ein Fahrgeschäft, dessen riesige freischwebende Stahlgitterstäbe Wagemutige hoch über das Gelände trugen, von wo aus sie einen atemberaubende Aussicht auf die Weiten des imperialen London hatten. Das eigentliche Thema der Show, die britischen und französischen Empires, war an das nördliche Ende der White City verbannt worden, wo Besuchern eine Auswahl kolonialer Bauten geboten wurde: Vertreten waren Tunesien, Algerien, Indien, Ceylon, Australien, Kanada und, am größten von allem, das pseudoirische Dorf Ballymaclinton, wo junge Colleens , irische Frauen, in einem von Konflikten und Republikanismus bereinigten Irland Butter rührten und Wolle spannen.
Das größte Gebäude auf dem Gelände war aber das Stadion. Ursprünglich sollte es im gleichen überbordenden Stil erbaut werden wie der Rest von White City, doch wurde es nie fertiggestellt, und ein Großteil bestand aus offenen Baugerüsten, provisorischen Zäunen und sehr einfachen Sitzbänken. Was aber an Ausstattung fehlte, machte es durch seine schieren Ausmaße wieder wett. In der Reklame für die Ausstellung hieß es, möglicherweise in Unkenntnis der griechischen Ursprünge der Spiele, das Stadion sei »so breit wie der Circus Maximus im alten Rom und länger als das Kolosseum«. Es war etwas mehr als 300 Meter lang an seiner größten Ausdehnung und hätte damit das gesamte Panathinaiko-Stadion von 1896 auf dem Spielfeld innerhalb der Laufbahn unterbringen können.
Sogar noch beeindruckender, was Einrichtung und Ausführung anbelangte, war der Imperial Sports Club, ein weiterer weißer Palast mit Kuppeldach. Er wurde am Südende des Stadions errichtet als Stützpunkt für das Organisationskomitee und um der feinen Londoner Gesellschaft eine angemessene Umgebung zu bieten, wenn sie den Spielen beiwohnte. Für die meisten der 1.900 Aristokraten und Diplomaten, die sich angemeldet hatten, vom Herzog von Westminster bis zum russischen Botschafter, war Shepherd’s Bush bis dahin Terra incognita gewesen. Der Imperial Sports Club war ein provisorisch errichteter Gentlemen’s Club inklusive getäfelter Speise- und Rauchzimmer. Die Mitgliedschaft beinhaltete Parkplätze für die frisch Motorisierten, einen Privateingang ins Stadion und die besten Plätze im Haus.
Читать дальше