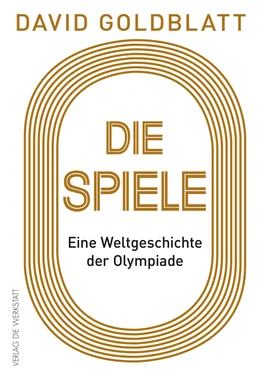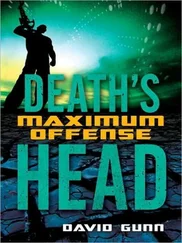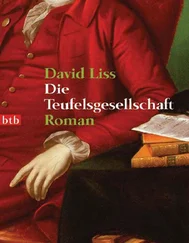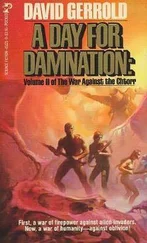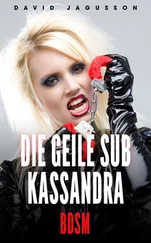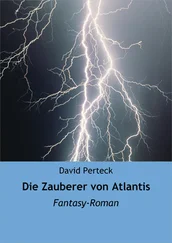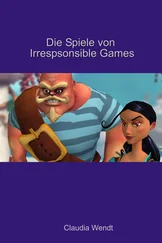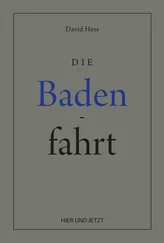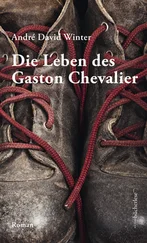Coubertin hatte sich seit Langem für Rom als Austragungsort der Spiele 1908 stark gemacht und begründete seine Wahl recht blumig damit, dass »nur dort allein, nach seinen Exkursionen ins utilitaristische Amerika, Olympos die kostbare, mit Geschick und Umsicht gewebte Toga anlegen könnte, in die ich ihn von Beginn zu kleiden gedachte«. 6Ein Organisationskomitee wurde gebildet, das es aber nicht schaffte, ein Budget zu erstellen, Mittel aufzubringen oder sich mit sportlichen und finanziellen Interessen im Norden des Landes zu arrangieren. Als sie kurz davor waren, die Spiele an das IOC zurückzugeben, bot sich den Italienern mit dem Ausbruch des Vesuvs die Chance, auf ehrenvolle Weise auszusteigen. Darauf verweisend, dass die knappen Gelder für den Wiederaufbau gebraucht würden, zogen sie sich zurück und machten damit den Weg frei für London und das britische aristokratische Sport-establishment. Die Olympischen Spiele 1908 in London wurden von der Sorte Gentlemen-Athleten organisiert, wie sie Coubertin am liebsten war, darunter der Vorsitzende der British Olympic Association, Lord Desborough, ein Politiker und Multisportler, Großwildjäger und Bergsteiger, begabt im Fechten, Cricket und Rudern. Und dennoch hing die ganze Veranstaltung von der Unterstützung Imre Kiralfys ab, eines ungarischen Juden und Theaterdirektors, dessen Franco-British Imperial Exhibition das Stadion und die Kulisse für die Spiele bereitstellen würde.
1912 bekam Coubertin endlich, was er sich erhofft hatte. Inzwischen hatte er die Kontrolle über das IOC zurückgewonnen, eine Reihe von Gegenspielern neutralisiert oder beseitigt und frische Kräfte angeworben, die sein Vermächtnis sichern würden, wie den japanischen Erziehungsreformer Kanō Jigorō, das erste asiatische Mitglied des Komitees, und den belgischen Grafen Henri de Baillet-Latour, der schließlich Coubertins Nachfolger werden sollte. Nachdem sie die Bewerbung Berlins zurückgewiesen und den Deutschen dafür die Spiele 1916 in Aussicht gestellt hatten, übergaben Coubertin und das IOC die Spiele 1912 an Stockholm und in die sicheren Hände des schwedischen Königshauses, der Armee und des ausgesprochen distinguierten Sportestablishments des Landes. Die Vergabe der Spiele war gebunden an die Forderung, die Spiele müssten »mehr rein athletischer Natur gehalten werden; sie müssen würdevoller sein, dezenter; mehr in Übereinstimmung mit den klassischen und künstlerischen Erfordernissen; intimer«. 7Vor allem würden dies die ersten Spiele seit 1896 unter der Leitung des IOC sein: losgelöst von Weltausstellungen und Messen, stattdessen jetzt mit der Feierlichkeit und dem Auftritt gesegnet, die Coubertin der Bedeutung des Projekts für angemessen erachtete.
Trotz gelegentlicher Fehltritte und einem gewagten Flirt mit der kommerziellen Volksnähe der Weltausstellungen waren die Spiele des IOC am Ende der Belle Époque noch immer eine glanzvolle Welt des vornehmen europäischen Amateursports. Einige wenige Profis aus der Arbeiterklasse schlüpften durch die Hintertür herein, doch sie wurden brüsk wieder abgewiesen. Weibliche Schwimmer, Bogenschützen, Tennisspieler und Golfer sprengten zumindest teilweise den rein männlichen Rahmen, der noch 1896 in Athen vorherrschte, doch im Großen und Ganzen blieben die Spiele und die meisten Disziplinen eine Domäne der Männer. Auf seine Art und Weise war Stockholm 1912 ein großer Erfolg, national wie international, und verankerte die olympische Bewegung sowohl in der globalen Kultur als auch im globalen Sport. Diese Verankerung war stark genug, dass die Institution und ihr Hang zum Pazifismus das Trauma des Ersten Weltkriegs überleben würde, der keine zwei Jahre später ausbrechen sollte. Das Gleiche galt leider nicht für die Dutzende Olympioniken, die in den Krieg ziehen und abgeschlachtet würden.
ZWEI
1892 geplant, von aufeinanderfolgenden französischen Regierungen großzügig finanziert und von Alfred Picard geleitet, war die Pariser Exposition Universelle von 1900 die größte und bestbesuchte alle Weltausstellungen der Belle Époque. In ideologischer Hinsicht präsentierte sie sich ebenso ambitioniert wie ambivalent. Einerseits sollte sie die Philosophie des 19. Jahrhunderts resümieren, andererseits zeigen, wie das neue Jahrhundert aussehen könnte. Sport würde ein Teil davon sein, aber in welcher Form genau, blieb abzuwarten. Das Bemühen der Organisatoren, den Sport innerhalb ihres umfassenden Klassifizierungsystems anzusiedeln, trieb hin und wieder abenteuerliche Blüten. Im offiziellen Katalog wurden Eislaufen und Fechten als Untersektionen der Besteckindustrie geführt, Rudern unter Lebensrettung, und Leichtathletikklubs waren unter gemeinnützige Vereine gelistet.
Es bestand allerdings kein Zweifel über die Auffassung der Organisatoren bezüglich der Bedeutung des Sports. Als Coubertin und sein Komitee ihr Programm für die Olympischen Spiele 1900 vorlegten, nicht unähnlich dem von Athen 1896, äußerte sich Picard verächtlich und befand es für »billig und ungeeignet, die Nation zu repräsentieren«, weder prächtig, populär oder demokratisch genug für die Dritte Französische Republik. 1Auch hatte er mit Coubertins Neo-Hellenismus und seinem seltsamen olympischen Spiritualismus nichts am Hut, die er als »absurde Anachronismen« erachtete.
Somit fanden die Olympischen Spiele 1900 ungefähr von Mitte Mai bis Ende Oktober statt, aber ohne Eröffnungsfeier und Schlusszeremonie, ohne Medaillen und Siegerkränze, Hymnen oder Chöre und ohne Spuren von olympischer Ikonografie in offiziellen Broschüren und Werbematerialien. Offiziell firmierten sie als die »Concours internationaux d’exercices physiques et de sports«, die Internationalen Wettbewerbe für Leibesübungen und Sport, aber die Presse war uneins darüber, wie sie einzelne Veranstaltungen nennen sollte, und bezeichnete sie, beinahe willkürlich, mal als »Festivalspiele«, als »Olympisches Festival« oder auch als »Internationale Spiele«. Bis heute ist umstritten, welche Darbietungen olympisch waren und welche nicht, und ob sie diesen Status erhalten, liegt allein im rückwirkenden Ermessen des IOC. Damals jedenfalls war sich fast niemand darüber im Klaren – weder Zuschauer noch Teilnehmer oder Presse –, dass überhaupt Olympische Spiele im Gange waren.
Unter den präsentierten Sportarten waren, außer Boxen, Gewichtheben und Ringen, alle, die schon 1896 dabei waren, dazu kamen einige, die in Athen noch gefehlt hatten, wie Fuß-ball, Rugby und Cricket, außerdem Pelota, Jeu de Paume, Golf, Bowling und Croquet. Noch weiter weg vom olympischen Kernprogramm umfassten die Spiele von Paris außerdem ein umfangreiches Motorsportprogramm, Ballonwettfahrten und Motorbootrennen, Wettbewerbe in volkstümlichen Beschäftigungen wie Angeln und Taubenrennen, Zusammenkünfte der feinen Gesellschaft bei Golf und Polo sowie Massenveranstaltungen mit bis zu 8.000 Turnern und 5.000 Bogenschützen, die die kleineren internationalen Wettbewerbe deutlich in den Schatten stellten. Darüber hinaus gab es nationale Bewerbe in Gefechtsbereitschaft und Lebensrettung, nationale Schulspiele und einen prestigeträchtigen wissenschaftlichen Kongress für Hygiene und Physiologie. Zwar waren die Sportler weitgehend Amateure, es herrschte aber kein generelles Verbot von Profis, für die es Sonderwettbewerbe in Rasentennis, Pelota, Schießen und Radfahren gab.
Der australische Sprinter Stanley Rowley war wenig angetan: »Diese Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften anzugehen, wäre eine regelrechte Beleidigung der wichtigen Veranstaltungen, die sie eigentlich sein sollen. Die meisten Teilnehmer fassen sie als EINEN GROSSEN WITZ auf.« 2Das Cricketturnier beschränkte sich auf ein einziges Match zwischen zwei britischen Teams, den tourenden Devon Wanderers und einer Mannschaft in Paris lebender Exilbriten. Beim Fußball waren drei Teams dabei, die englischen Amateure von Upton Park, eine von der USFSA zusammengetrommelte französische Elf und ein Haufen belgischer Studenten. Die Mosley Wanderers, die englischen Vertreter des ebenso winzigen Rugbyturniers, trafen ein, spielten und reisten noch am gleichen Tag wieder ab, ohne sich dessen bewusst zu sein, an Olympischen Spielen teilgenommen zu haben.
Читать дальше