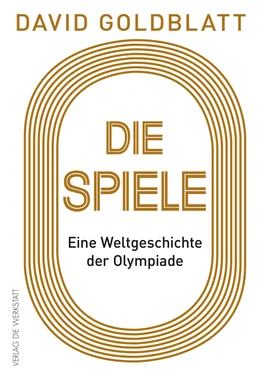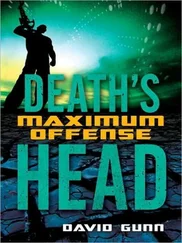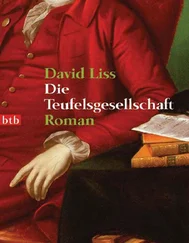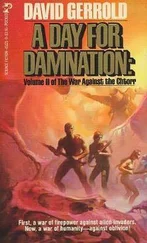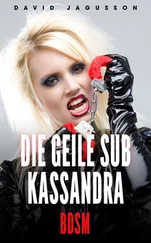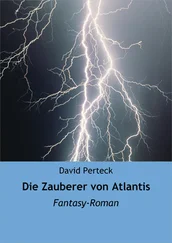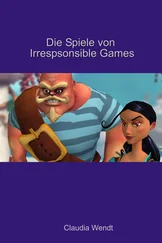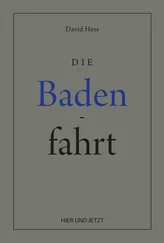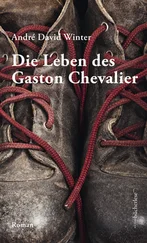Die Schlussfeier, die wegen schlechten Wetters um einen Tag verschoben wurde, hatte etwas von einer ausgelassenen Schulparty, gleichzeitg erwies sie antiken Traditionen – wenn auch erst kürzlich ersonnenen antiken Traditionen – ihre aufrichtige Ehrerbietung. G. S. Robertson brachte sich mit der ganzen Chuzpe und Selbstgefälligkeit, die der herrschenden britischen Klasse auf dem Gipfel ihrer Macht innewohnte, in die Feierlichkeiten ein und trug eine Siegesode an die Spiele selbst vor, die er nach antikem Vorbild und auf Altgriechisch verfasst hatte. Die Athleten wurden von Herolden einzeln angekündigt und erhielten aus den Händen des Königs ihre Preise: Silbermedaillen und Olivenzweige aus dem heiligen Hain in Olympia für die Sieger, Bronzemedaillen und Lorbeerzweige für die Zweitplatzierten. Spyridon Louis erhielt seinen ganz eigenen, von Bréal gestifteten Marathon-Pokal und eine antike griechische Vase, danach gab es Urkunden für alle anderen. Die strenge Kleiderordnung sah schwarze Krawatte und Zylinder vor, außer für Louis, der eine Fustanella trug, den traditionellen Männerrock der griechischen Landbevölkerung. Als er erschien, so ein Beobachter, »erhob sich ein Rumpeln wie Donner von allen Seiten«. Die Sieger machten eine Ehrenrunde durchs Stadion, nahmen den Applaus des Publikums entgegen, und dann erklärte der König die »Ersten Internationalen Olympischen Spiele« für beendet.
Es waren internationale Spiele gewesen, sie wurden aber auch als ausgesprochen griechischer Triumph aufgefasst. Der amerikanische Beobachter Rufus B. Richardson bemerkte ebenso edelmütig wie herablassend: »Es ist ein kleines und armes Königreich, aber, so wie das antike Hellas, reich an guten Eigenschaften der Seele.« Der griechische Historiker Spyridon Lambros verglich die Lage der Nation während der Spiele mit der Zeit politischer Umwälzungen und sozialer Rückständigkeit vor der Einsetzung des herrschenden Königshauses und befand, dass »das Griechenland von 1896 das Griechenland von 1862 weit hinter sich gelassen« habe.
In der Tat fühlte sich die Monarchie dermaßen ermutigt durch den Erfolg der Olympischen Spiele, dass der König, im Rahmen eines Banketts, das während der Spiele für alle Athleten und ausländischen Würdenträger abgehalten wurde, sich fragte, ob man »unser Land als friedlichen Treffpunkt der Nationen, als beständigen und permanenten Schauplatz der Olympischen Spiele einsetzen« sollte. In seinen Memoiren schrieb Coubertin dazu säuerlich: »Ich beschloss, den Einfaltspinsel zu spielen, einen Mann, der nichts verstand. Ich beschloss, die Rede des Königs zu ignorieren.« 9Ebenso pikiert reagierte er angesichts des Versäumnisses seitens des Königshauses oder der Presse, seine Rolle bei der Wiederbelebung der Spiele angemessen zu würdigen: »Mir ist einerlei, was die griechischen Zeitungen über mich schreiben. Wenn es um Undank geht, trägt Griechenland leicht den Sieg davon … Ihr bekamt alle eure Zweige – selbst Mr. Robertson – im vollen Stadion aus den Händen des Königs. Ich bin der Einzige, dessen Name, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand genannt wurde.« 10
Das internationale Publikum war ungemein beeindruckt. Die meisten befanden, dass die Spiele etwas eingefangen hätten, was sie als die Herrlichkeiten der Antike erachteten. G. S. Robertson meinte, ihr Erfolg läge im »Triumph des Gefühls, der Verbundenheit, der Auszeichnung, der einzigartigen Pracht« begründet. Rufus B. Richardson war »beinahe überzeugt, dass die alten Zeiten zurückgekehrt waren, als es nichts Ernsthafteres zu tun gab, als zu überlaufen, zu überlisten und zu überwältigen«. Der Sieger im Hochsprung, Ellery Clark, der die Chance hatte, die Spiele von Athen mit späteren Austragungen zu vergleichen, an denen er teilnahm, schrieb, dass »nichts der ersten Neuauflage gleichkam. Der Duft des athenischen Bodens, der unbestimmbare poetische Reiz, dadurch gleichsam mit der Vergangenheit verbunden zu sein, ein Nachfahre der großen heroischen Gestalten vergangener Tage – der vortreffliche Sportsgeist des ganzen Unterfangens.«
Charles Waldstein erklärte die Spiele, wie von einem langjährigen Befürworter des Projekts wohl nicht anders zu erwarten, zu »einem gewaltigen Erfolg«. Doch am ehesten lässt sich ermessen, wie viel Eindruck die Spiele machten – zumindest bei denen, die dabei waren –, wenn man sich die Reaktionen früherer Skeptiker wie G. S. Robertson anschaut: »Allen, die die Vorbereitungen zur Wiederbelebung der Olympischen Spiele aufmerksam verfolgt hat-ten, erschien es gewiss, dass die Spiele ein verheerender Misserfolg würden. Dies war nicht der Fall, wenngleich der Charakter des erreichten Erfolges wohl kaum den Erwartungen der Befürworter entsprochen haben wird.« 11Aber wie bei fast jedem Projekt – mochte ihm auch ein wunderbarer Anfang vergönnt gewesen sein – bestand die eigentliche Herausforderung darin, das Ganze zu wiederholen.

Menschen, Sportler, Sensationen: Die Olympischen Spiele am Ende der Belle Époque
Paris 1900 • St. Louis 1904 • Athen 1906 • London 1908• Stockholm 1912 • Berlin 1916
»An Weltausstellungen ist es ein eigentümlicher Reiz, dass sie ein momentanes Zentrum der Weltkultur bilden, dass die Arbeit der ganzen Welt sich, wie in einem Bilde, in diese enge Begrenzung zusammengezogen hat.«
Georg Simmel
Wir sollten darauf achten, nicht zuzulassen, dass die Spiele jemals von einer großen Schau abhängig oder vereinnahmt werden, wo ihr philosophischer Wert sich in Luft auflöst und ihr erzieherischer Nutzen gleich null ist. … Erst 1912 wurde der Bruch in Schweden endgültig vollzogen. … Der Olympismus würde nicht mehr das Dasein eines demütigen Vasallen fristen.
Baron de Coubertin
EINS
Von den Trümmern der Zwischenkriegsjahre blickten die Franzosen auf die drei oder vier Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zurück und erklärten sie zur »Belle Époque«. Die Amerikaner erinnerten sich dieser Zeit als »Gilded Age«, die Briten als Blüte viktorianischer und imperialer Macht. Europa und Amerika hatten fast vier Jahrzehnte enormen industriellen Wachstums und tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen erlebt. Dazu kam eine ganze Reihe epochaler technologischer Innovationen, von der Elektrizität über die motorisierte Luftfahrt bis zum Automobil. In einer Welt, die vernetzter war als je zuvor, dehnten die Großmächte ihre Herrschaftsgebiete in Übersee aus, untereinander aber herrschte Frieden.
Diese enormen Veränderungen wurden gefeiert in den Weltausstellungen. Der deutsche Soziologe Georg Simmel nannte sie ein »momentanes Zentrum der Weltkultur«, denn hier verdichteten sich der kulturelle Austausch und die Interaktionen jener Zeit. 1Sechs Millionen Menschen, fast ein Viertel der englischen Bevölkerung, besuchten 1851 den Crystal Palace; der gleiche Anteil der amerikanischen Bevölkerung, insgesamt 28 Millionen, war 1893 bei der World’s Columbian Exposition in Chicago zu Gast. 15 Millionen kamen 1867 nach Paris, 1889 waren es 23 Millionen und 1900 gar 50 Millionen, und damit mehr als die französische Gesamtbevölkerung. 2
Freilich waren es mehrheitlich einheimische Besucher, aber die Ausstellungen lockten auch zahlreiche Touristen an. Dutzende ausländische Regierungen und Unternehmen sponserten Pavillons, und ein immer größeres Pressekorps aus aller Welt berichtete über sie. Doch der Versuch der Ausstellungen, die Menschheit in einem Thema oder mit einer Reihe von Pavillons zusammenzufassen, wurde stets durch den gebrochenen Charakter der Globalisierung am Ende des 19. Jahrhunderts untergraben. Falls es so etwas wie eine Weltkultur gab, so war sie keinesfalls homogen, sondern gespalten durch globale imperiale Rivalitäten und zutiefst gestört durch militärisches Schattenboxen und aufkommenden Nationalismus.
Читать дальше