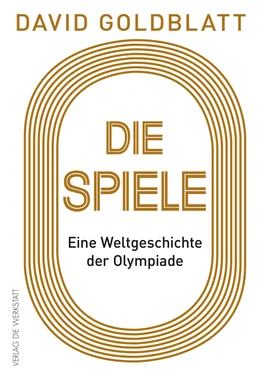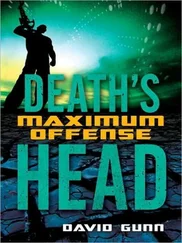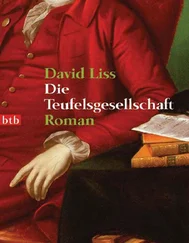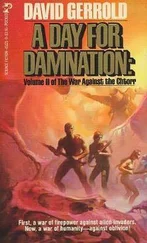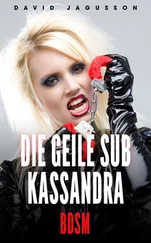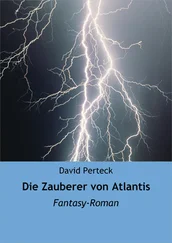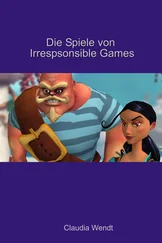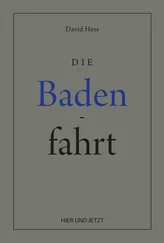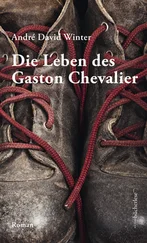In dieses Vakuum hinein schritt das Könighaus, allen voran König Konstantin. Er setzte ein neues Organisationskomitee ein, das er selbst leitete, mobilisierte die persönlichen Netzwerke der Monarchie, löste ein paar Gefälligkeiten ein und begann mit den Vorbereitungen. Neben einigen öffentlichen Spenden sicherte er dem Komitee eine enorme Schenkung von Georgios Averoff, einem reichen griechischen Unternehmer, der in Alexandria lebte und bereits eine ganze Reihe öffentlicher Projekte und Nationaldenkmäler finanziert hatte. Dank einer Spende von fast einer Million Drachmen konnte das antike Panathinaiko-Stadion, das für die Olympien der vorigen Jahre teilrenoviert worden war, vollständig neu errichtet und in Marmor ausgekleidet werden. Für seinen Einsatz bekam Averoff eine eigene Statue vor dem Stadion. Nach dem Sturz der Regierung Trikoupis im Jahr 1895 erhielt das Komitee von der eher olympiafreundlich gesinnten Nachfolgeregierung umfangreiche Darlehen, die groß genug waren, um mit dem Bau eines neues Velodroms und einer Schießanlage zu beginnen, gesichert durch Ticketverkäufe und die Herausgabe von Gedenkbriefmarken.
Die letzten Monate der Vorbereitung waren von vielen der Kapriolen begleitet, die auch heute noch die olympische Berichterstattung kennzeichnen. Hartnäckig hielten sich Gerüchte, das Stadion und andere Anlagen würden nicht rechtzeitig fertig, was zu einem fieberhaften Briefwechsel in der Times führte. Ausländische Journalisten, wie dieser Korrespondent der New York Times , reisten an, um vor Ort im Dreck zu wühlen: »Reichlich alte Blechdosen und Unrat lagen verstreut, wo einst der silberne Odysseus aufs Meer hinaus strahlte: Der Hain der Platonischen Akademie erinnerte mich an pittoreske Ansichten eines Elendsviertels.« 2Die Enthusiasten und Förderer hingegen waren voll des Lobes, wie auch Coubertin in seinem beschwingten Brief aus Athen , der vor den Spielen veröffentlicht wurde: »Überall polieren die Menschen den Marmor, bringen neuen Putz auf und frische Farbe; sie pflastern, säubern, schmücken … Jeden Abend gegen fünf Uhr kommen die Bürger her, um einen anerkennenden Blick auf die Arbeit zu werfen, die am Stadion verrichtet wird.«
Augenzeugenberichte lassen darauf schließen, dass in ganz Athen große Vorfreude herrschte. Die Spiele begannen, so wie Panagiotis Soutsos es ein halbes Jahrhundert zuvor gefordert hatte, am griechischen Unabhängigkeitstag. In der Stadt wimmelte es von Besuchern, deren »polyglotte Sprachverwirrung beinahe einem Babel gleichkam«, während die Menge sich um Eintrittskarten für die Eröffnungsfeier balgte; die Schätzungen schwanken zwischen 50.000 und 70.000 Zuschauern. Der Autor Anninos erinnerte sich an den Moment: »Die verschiedenen Aufmachungen der Damen, ihre vielfältigen Frisuren, die Bewegungen ihrer Fächer inmitten der schwarze Masse mehrerer Tausend Zuschauer, die glänzenden Uniformen und die Federbüsche der Offiziere, die markanten Farben der wallenden Fahnen, der rege Halbkreis der Zuschauer, die, ohne Eintrittskarten, die Hügel rund um das Stadion besetzten, ergaben einen höchst eigentümlichen und imposanten Gesamteindruck.« 3
Die Ankunft der königlichen Entourage signalisierte den Beginn der offiziellen Feierlichkeiten. Der Kronprinz hieß den König willkommen. Der König eröffnete die Spiele, und die Kapelle stimmte die olympische Hymne an. »Die Stille, die der beeindruckenden Darbietung folgte, zeugte von gespannter Erwartung; die Olympischen Spiele standen kurz davor, nach einer Unterbrechung von mehreren Hundert Jahren, wiederaufzuerstehen. Unvermittelt erklangen die klaren, durchdringenden Stöße eines Horns, und aus dem antiken Tunnel … erschienen die Teilnehmer des ersten Wettbewerbs.« 4
Im Laufe der nächsten zwei Wochen maßen sich 241 Athleten in 43 Wettbewerben in neun verschiedenen Disziplinen: ein kleiner, aber aufschlussreicher Querschnitt der urbanen Eliten der industrialisierten Welt und ihrer Sportkultur. Sie waren natürlich ausschließ-lich Männer und, mit Ausnahme der glattrasierten amerikanischen College-Boys, trugen sie alle den typischen gewichsten Schnurrbart der jungen Sprösslinge des Großbürgertums und der Aristokratie, den die aufstrebende Mittelklasse nachäffte. Sie waren außerdem samt und sonders weiße Europäer oder Nordamerikaner europäischer Herkunft. Das Nationale Olympische Komitee Chiles pocht zwar weiterhin darauf, dass Luis Subercaseaux Errázuriz, der damals in Frankreich zur Schule ging und später als Botschafter im Vatikan und reiselustiger Diplomat fungierte, in den Vorläufen über 100 m, 800 m und 1.500 m angetreten sei, was aber niemand, auch nicht das IOC, bestätigen mag. Die griechische Mannschaft speiste sich aus der gesamten Diaspora, wobei die Auswahl eher auf Ethnizität denn auf tatsächlicher Staatsangehörigkeit basierte, mit Athleten aus Ägypten, Anatolien und Zypern, das damals Teil des Britischen Empire war. Die Bulgaren versuchten, den Schützen Charles Champaud als einen der ihren zu deklarieren, aber er war zweifelsfrei ein Lehrer aus der Schweiz.
Wenngleich einige wenige Athleten aus eher bescheidenen griechischen Familienverhältnissen stammten, traf das für die große Mehrheit nicht zu. Unter den Medaillengewinnern im Schießen waren Pantelis Karasevdas und Ioannis Frangoudis, damals junge Kadetten, die zu ranghohen Offizieren in der griechischen Armee heranwuchsen. Charilaos Vasilakos, ein Jurastudent und Marathonläufer, stieg bis an die Spitze des öffentlichen Dienstes auf, während die Fechter Ioannis Georgiadis und Periklis Pierrakos-Mavromichalis Karriere als führender Toxikologie-Professor des Landes bzw. Minister des Inneren machten. Die Amerikaner, die nach Athen kamen, waren ebenso blaublütig, die meisten von ihnen waren Studenten aus Harvard, Princeton oder dem exklusiven Boston Athletic Club. Die Ungarn, Österreicher und Deutschen waren überwiegend Männer aus der gehobenen Mittelschicht, darunter viele jüdische Athleten wie der ungarische Schwimmchampion und spätere Architekt Alfréd Hajós oder die österreichischen Schwimmer Otto Herschmann, seines Zeichens Anwalt, und Paul Neumann, der später Medizin studierte. Die Deutschen, alle voran die Turner, kamen gegen den ausdrücklichen Willen des ultranationalistischen Deutschen Turnerbunds, des obersten Wächters der deutschen Version modernen Sports. Er erachtete die Spiele als so alarmierend undeutsch und kosmopolitisch, dass er seinen Mitgliedern unter Androhung des Ausschlusses die Teilnahme untersagte.
Das britische Aufgebot war klein und bestand aus nur sechs Athleten – eine Folge der hochmütigen Indifferenz des Sportestablishments gegenüber Coubertins Projekt und des »selbstmörderischen Grundsatzes der Veranstalter, den Athleten vom Kontinent größere Beachtung zu schenken«, wie G. S. Robertson, frischgebackener Oxford-Absolvent und Hammerwerfer, es formulierte. 5In Abwesenheit des Kerns der britischen Sportelite – die Studenten aus Oxford und Cambridge, die Streitkräfte und die Klubs aus London – hatte die britische Delegation ein eher imperiales Flair, und die Teilnehmer stammten hauptsächlich aus den Kolonien. Charles Gmelin, Sprinter aus Oxford, wurde in Bengalen als Kind christlicher Missionare geboren. Sein Kommilitone John Boland, Sohn eines irischen Geschäftsmanns und später Parlamentarier der irischen Nationalisten in Westminster, gewann das Tennisturnier im Herreneinzel. Launceston Elliot, der sich im Gewichtheben und Ringen versuchte, kam in Indien zur Welt und entstammte einer schottischen Adelsfamilie, die viele imperiale Ämter bekleidet hatte. Gesellschaftlich weiter unten arbeitete der Mittelstreckenläufer Edwin Flack für das Steuerbüro seines Vaters in Australien. Auf der untersten Stufe standen die britischen Radfahrer Edward Battell und Frederick Keeping, aus Irland bzw. England, die beide dem Hauspersonal der britischen Botschaft in Athen angehörten, eine Beschäftigung, die dem Professionalismus so gefährlich nah war, dass das Organisationskomitee mit dem Gedanken spielte, sie von den Spielen auszuschließen.
Читать дальше