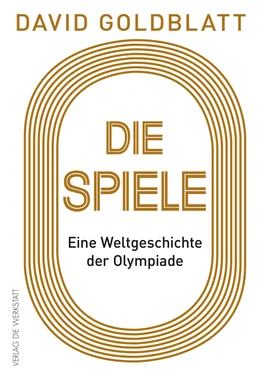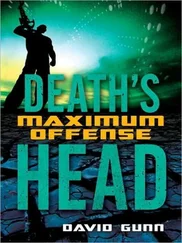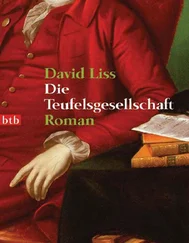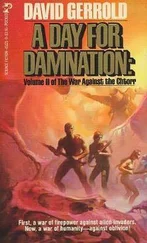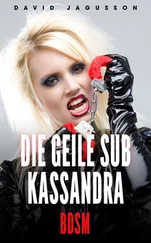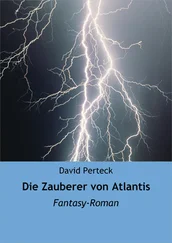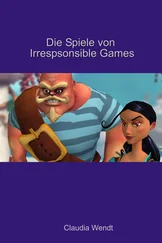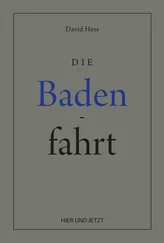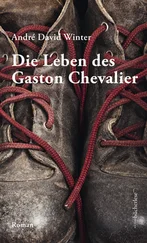Coubertin war nie ein Mann für komplexe Wahrheiten und beschrieb das Verhältnis zwischen den frühen Olympischen Spielen und den Weltausstellungen als ein »demütigendes Vasallentum«. Gewiss war es eine Beziehung, die ihm viel von der Kontrolle darüber entzog, wo die Spiele ausgetragen wurden, und sie stimmten auch nicht immer überein mit dem neohellenischen Athletenkult des Barons und dessen synkretischer Mixtur aus Kraftmeierei und Internationalismus. Coubertins persönlichen Groll beiseite, hatte er recht, wenn er beklagte, dass die Olympischen Spiele der Belle Époque im öffentlichen Bewusstsein und in der Berichterstattung von den größeren Festivitäten überschattet wurden, in die sie eingebettet waren. Andererseits war Sport für einen Großteil der Oberschicht nur von geringem Interesse verglichen mit technischen Wunderwerken, Konsumentenfantasien im Überfluss und morgenländischer Freizeitpark-Exotik. In Ermangelung sonstiger Geldgeber boten die Ausstellungen außerdem das erforderliche Umfeld und den finanziellen Rahmen, in dem solcherlei Spiele stattfinden und das globale Ansehen des Sports im Allgemeinen und der Olympischen Spiele im Besonderen etabliert werden konnte. Den großspurigen Universalismus der Weltausstellungen, ebenso wie deren komplexes Verhältnis zu Wirtschaft und Kommerz, haben sich die Spiele bis heute bewahrt. Dazu kommt, dass die Spiele immer größere Bedeutung für die sozialen und ökonomischen Strukturen der Gastgeberstädte haben und auch enger gefasste und auf die Gemeinde beschränkte Agenden vorantreiben können.
Was wünschten die Menschen zu sehen, die zu den Ausstellungen strömten? Wie die vollständige Bezeichnung der allerersten Ausgabe, der Londoner Industrieausstellung von 1851, nahelegt – »Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations« (Große Ausstellung der Industrieerzeugnisse aller Nationen) –, kamen sie, um die Maschinen und Produkte zu sehen, die die neue globale Industriewirtschaft ausmachten: die Güter, die Energiequellen und die neuen Stützen der elektronischen Kommunikation und des mechanisierten Transports, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs ein historisch beispielloses Maß an internationalem Handel, Investitionsaufkommen und kulturellem Austausch hervorbrachten. 1876 strömten die Massen nach Philadelphia, um das Telefon zu sehen; spätere Ausstellungen präsentierten die Schreibmaschine, elektrisches Licht, Rolltreppen, die Tonaufzeichnung, das Kino und Röntgenapparate. Viele heute global allgegenwärtige Produkte – wie Zuckerwatte, der Hot Dog und der Reißverschluss – und Marken – wie Heinz-Ketchup und Dr. Pepper – nahmen in dieser Ära des aufkommenden Massenkonsums ihren Anfang.
Aber trotz des ungezügelten Kommerzes strebten die Weltausstellungen stets danach, mehr zu sein als eine bloße Übung in Produktentwicklung und Marketing. Außer industriellen Errungenschaften zeigten sie die neuesten Ideen und Innovationen in Bereichen wie Agrarkultur, Stadtentwicklung, Militärtechnik, Medizin und Hygiene, Kunst und Musik. Ihre Gestaltung und Kataloge zeigten alle Arten von Methoden auf, die zunehmend komplexe Welt zu klassifizieren und zu analysieren, indem sie die Systematiken der Museen und der Altertumsforscher, der Enzyklopädien und der Bibliothekskataloge miteinander verknüpften. Da sie die Aufmerksamkeit von Besuchern aus aller Welt auf sich zogen, bildeten sie das perfekte Umfeld, um internationale Kulturkonferenzen jeglicher Art auszurichten. So war die Chicagoer Weltausstellung 1893 Tagungsort des Weltparlaments der Religionen, des Weltkongresses der Frauen und des Internationalen Kongresses der Mathematiker. 1904 versammelten sich in St. Louis beim Internationalen Kongress für Kunst und Wissenschaft Tausende Gelehrte aus der ganzen westlichen Welt und stellten sich selbst die zum Scheitern verurteilte enzyklopädische Aufgabe, Wissensstand und Fortschritt Hunderter akademischer und intellektueller Teilgebiete zu sichten. Sie wollten wissen, ob es möglich wäre, dies alles als großes, zu vereinheitlichendes System universeller Vernunft zu verstehen.
Das Konzept der Weltausstellungen war dehnbar genug, um an eine beliebige Zahl imperialer oder nationaler Kulturprojekte angepasst zu werden. Die Londoner Industrieausstellung war natürlich ein Ausdruck britischer ökonomischer Modernität und Dominanz in einer Zeit, als die »Werkstatt der Welt« 50 Prozent aller industriegefertigten Güter produzierte, betonte aber auch die wachsende globale Tragweite und Bedeutung des Empire. Andere europäische Mächte, von Spanien bis Deutschland, reagierten mit eigenen Leistungsschauen. Das österreichisch-ungarische Kaiserreich, das auf industrieller Ebene nicht mithalten konnte, machte die Weltausstellung 1873 in Wien zu einer Feier von Bildung und Kultur. Die Belgier erkoren das Automobil und ihren neuen Freistaat Kongo zu den Hauptattraktionen der Schau. Die imposantesten Statements lieferten aber die Amerikaner und Franzosen. Die Centennial Exhibition 1876 in Philadelphia betrachtete die moderne Welt durch die Linse eines Jahrhunderts amerikanischer Unabhängigkeit. Chicago 1893 datierte die Moderne, mit einem Jahr Verspätung, ab der »Entdeckung« durch Kolumbus 400 Jahre zuvor. Die Dritte Französische Republik knüpfte ihre Exposition Universelle im Jahr 1900 an das beginnende neue Jahrhundert.
So wie die modernen Olympischen Spiele waren die Weltausstellungen ebenso urbane wie nationale oder globale Veranstaltungen, die eher mit der Gastgeberstadt als mit ihrem jeweiligen Nationalstaat assoziiert wurden. Obwohl ein Großteil der Infrastruktur der Ausstellungen nur provisorisch errichtet wurde, hinterließen sie deutliche Spuren in Gestalt und Baustruktur der Städte wie auch der urbanen Vorstellungswelt. Der Eiffelturm, für die Exposition Universelle 1889 errichtet und ursprünglich nicht als permanentes Bauwerk vorgesehen, ist das heute wohl bekannteste Beispiel für die markante Architektur, die die Weltausstellungen der Belle Époque hervorbrachten. Damals aber begeisterte sich das weltweite Publikum an Joseph Paxtons Crystal Palace – eine Art schmiedeeiserne Industriemutation eines feudalen Treibhauses –, an der Rotunde in Wien und der White City in Chicago. Angesichts der enormen Zuschauerzahlen war unausweichlich, dass sich am Rand der Weltausstellungen auch kommerziellere und reißerische Spektakel breitmachten, wie z. B. 1889 in Paris Buffalo Bills immens populäre Wildwest-Show.
Wo also war innerhalb dieses riesigen Kuriositätenkabinetts der Sport zu finden? Anfangs nahm er nur einen kleinen Platz ein, genauer gesagt die North Transept Gallery der Great Exhibition, wo viktorianischen Sportenthusiasten im Rahmen der Ausstellung »Sonstige Erzeugnisse und kurze Waren« u. a. Tennisrackets, Golfbälle aus Schottland, Angelruten, Billardtische sowie das erste überlieferte Croquet-Set inklusive Regelwerk geboten wurden. Dazu gab es Cricket-Zubehör, Schläger-Prototypen und, »in Ermangelung eines erstklassigen Bowlers«, ein ledernes Katapult. Der Sportartikelhersteller Gilbert stellte »eigens für den Zweck gefertigte lederne Fußbälle« bereit, für Bogenschützen gab es ein Sortiment an »englischen Langbogen für Damen und Herren, gefügt aus verschiedenen raren Holzsorten«. 31867, im Rahmen der Exposition Universelle im Zweiten Französischen Kaiserreich, war ein kleiner Teil des Areals dem Thema Sport und Ertüchtigung vorbehalten. Dort gab es u. a. das Modell einer »sächsischen« Turnhalle und neue Fahrräder zu bestaunen.
Wenn man bedenkt, dass der Sport bei diesen Veranstaltungen nur eine Randerscheinung war, ist es bemerkenswert, wie oft die Ausstellungen selbst mit den antiken Olympischen Spielen verglichen wurden – statt um panhellenische sportliche Wettkämpfe unter griechischen Stadtstaaten ging es nun um den globalen ökonomischen Wettbewerb zwischen modernen Nationen. Der Spectator beschrieb die Londoner Great Exhibition als »diese Olympischen Spiele der Industrie, dieses Turnier des Handels«. Die Amerikaner stellten 1876 in Philadelphia den gleichen Bezug her: »Was die Olympischen Spielen den Stämmen Griechenlands waren, das sind, im Geiste der modernen Zeiten, die universellen Ausstellungen den Stämmen, den Nationen der zivilisierten Welt.«
Читать дальше