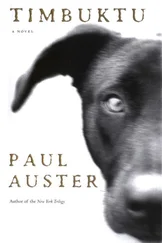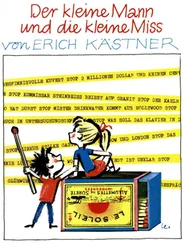In Kampala gab es außer uns nicht mehr viele Ausländer. Im International jedenfalls waren Kogelfranz und ich die einzigen Weißen. Es war ganz klar, dass nur wir gemeint sein konnten. Eine halbe Stunde später jagten wir in unserem Mietwagen Richtung Jinja und von dort weiter nach Kenia.
Unsere Vorsicht war von Erfahrung unterfüttert. Der britische Universitätsdozent Denis Hills, der letzte Weiße, den die Amin-Administration als Staatsfeind vorgeführt hatte, war dem Galgen nur deshalb entgangen, weil Amin gerade keine Affäre gebrauchen konnte. Er wollte auf der bevorstehenden Gipfelkonferenz der Staatschefs zum »Präsidenten von Afrika« gewählt werden, wie er es nannte. Nach der Nominierung hätte er Hills hängen lassen können, doch dann bemühte sich der britische Premierminister James Callaghan persönlich nach Uganda, um sein Leben zu retten.
Der dicke Depp hatte ein Gedächtnis wie ein Elefant. Er pflegte eine ganz spezielle Wut gegen die Briten, weil die Erinnerung an die Demütigungen nie erloschen war, die er als Soldat der Queen’s African Rifles hatte erdulden müssen.
Ich hatte mich bis dahin in Uganda immer sicher gefühlt. Gegen die Deutschen hatte Amin grundsätzlich nichts einzuwenden. Nach einem Besuch in der Bundesrepublik hatte er sich zwar verstört darüber gezeigt, dass sie einem so großen Sohn wie Adolf Hitler keine Denkmäler errichtet hatten. Aber er verehrte sie trotzdem. Vor allem wegen ihrer großartigen militärischen Leistungen im Zweiten Weltkrieg, wie er sagte.
Amins primitive Germanophilie war für Deutsche schwer zu ertragen. Ein deutscher Grenzschützer war dabei gewesen, als Amin auf einer Party im Kreise von Lakaien bemerkte: »The Germans are very efficient. They have burnt a hundred thousand Jews on the soil of Germany.«
Botschafter Richard Ellerkman und mich verband ein in zweieinhalb Jahre gewachsenes Verhältnis, das man in Diplomatenkreisen als sachlich bezeichnet. Er war zur Gratulationscour bei Amin angetreten, als der sich selbst die Feldmarschallsepauletten auf die Schultern applizierte.
In einem nicht unwichtigen Punkt hatte Ellerkmann mit seiner Diplomatie gegenüber Idi Amin Recht: Die Greuelstatistiken, die in den westlichen Zeitungen verbreitet wurden, waren übertrieben. In Uganda wurde nicht eine halbe Million Angehörige von Minderheiten mit Hackmessern massakriert wie in Ruanda. Aber die bestialische Routine, mit der Menschen wie Ungeziefer getilgt wurden, hat Amin einen sicheren Platz im Gesamtklassement der afrikanischen Massenmörder gesichert.
Gut möglich, dass der nach Ellerkmanns Ansicht verbogene Geschmack von Siegfried Kogelfranz seinen Teil zu unserem schlechten Standing beigetragen hat. Am Tag nach unserer Einreise hatten wir der Botschaft einen Höflichkeitsbesuch abgestattet. Dabei trug Kogel seine schrillen Stiefeletten, die auch meiner Geschmacksempfindung nach eine Beleidigung für das männliche Geschlecht waren: gesteppte durchfallgelbe Treter mit pinkfarbenen Druckknöpfen. Ellerkmanns angewiderter Blick zeigte deutlich, dass er die hässlichen Klotschen eines Spiegel -Redakteurs für unwürdig hielt. Und so wurden wir auch behandelt. Es gab nicht mal einen Kaffee.
Auf der rund tausend Kilometer langen Fahrt nach Nairobi wurden Kogel und ich nicht behelligt. Vielleicht waren wir überängstlich gewesen. Aber ich hatte gerade eben die Dokumentation des Volksschullehrers gelesen, der im Makindye-Gefängnis in Kampala inhaftiert gewesen war. Allein das Wort »Makindye« löste Urängste in mir aus. Ich war mal besuchsweise eine Stunde drin gewesen. Es war schon in der Vor-Amin-Zeit ein Alptraum.
In dem Bericht des Lehrers hieß es: »Wir hatten Hunger, wir waren alle sehr erregt, und wir haben uns so geschämt. Aber da waren die Gewehre. Da mussten wir es tun. Einer der Soldaten kam und sagte, das Essen sei schon aufgetragen.« Und dann haben sie es getan. Sie haben einen ermordeten Mitgefangenen aufgefressen.
Der Lehrer hat auch berichtet, wie er und einige seiner Kameraden gezwungen worden waren, 27 halbverhungerten und von schweren Folterungen gezeichneten Gefangenen mit Schmiedehämmern die Schädel einzuschlagen. Er sagte unter Tränen: »Ich selbst habe drei umgebracht und ich schäme mich deswegen.« Der Befehl für die Hammermetzelei sei direkt vom Präsidenten gekommen.
Ich habe mich gefragt, warum das Problem Amin nicht einfach von einem Mietkiller gelöst wurde. Moralische Bedenken können der Liquidierung eines solchen Ungeheuers doch nicht entgegengestanden haben. Politischer Mord ist auch nach den Maßstäben der westlichen Wertegemeinschaft unter Umständen dispensfähig. Warum hat die CIA nicht eine von ihren fabelhaften Killerpillen oder ihre präparierte Hühnersuppe eingesetzt, mit denen ihre Agenten Fidel Castro so zugesetzt hatten. Es kann nur daran gelegen haben, dass CIA-Agenten nur dann gewalttätig wurden, wenn es ihnen politisch opportun erschien, aber nicht, wenn das Gesetz der Menschlichkeit es erfordert hätte.
Keine Frage, dass der Mörder Amins das gleiche Recht für sich hätte in Anspruch nehmen können wie Stauffenberg. Und Idi Amin umzubringen, das wäre kein so schwieriger Job gewesen. Er bewegte sich vollkommen ungezwungen und kaum geschützt in der Öffentlichkeit. Ich war ihm mehrfach so nah, dass ich es auch hätte tun können, zwei-, dreimal sogar ziemlich risikolos. Und ich müsste erst über die Antwort nachdenken, wenn mich jemand fragen würde, warum ich es nicht getan habe.
Ich habe auch das bessere Uganda kennengelernt – in Gestalt des späteren Staatspräsidenten Yoweri Museveni. Und zwar im D-Zug zwischen Osnabrück und Hamburg-Hauptbahnhof. Museveni war als Gast der Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland zu Besuch. Er war damals für Uneingeweihte ein Nobody. Ich musste heftig in die Saiten greifen, um Spiegel -Auslandschef Dieter Wild ein Museveni-Interview zu verkaufen.
Museveni hatte auch einen Termin beim Afrika-Verein in Hamburg. Weil er schon am nächsten Tag nach Berlin weiterfahren sollte, musste ich ihm per Bahn entgegenfahren, um ihn zu sprechen. Das Gespräch war fruchtbar, weniger für den Spiegel als für mein persönliches Afrikabild. Museveni war einer der gescheitesten Afrikaner, die ich in vielen Jahren getroffen hatte. Irgendwo auf der Höhe von Rotenburg an der Wümme ergriff er meine Hand und sagte: »Schreiben Sie was Gutes über mich und mein Volk. Vielleicht hilft es mir dabei, Präsident von Uganda zu werden. Das ugandische Volk wird es Ihnen danken.«
Zwei Jahre danach war er tatsächlich Präsident. Doch Uganda brauchte noch etliche Jahre, um sich von den Folgen der Diktatur zu erholen. So, wie sich Museveni dann politisch entwickelte, hätte das Volk von Uganda auch immer weniger Anlass gehabt, mir dankbar zu sein, wenn ich denn wirklich Einfluss auf die Entwicklung gehabt hätte.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.