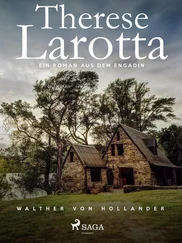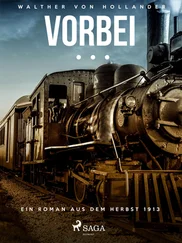„Entschuldige“, beginnt er wieder, „ich rede da die ganze Zeit nur von mir. Komm, setzen wir uns. Hier. Nein, du aufs Bett. Ich werde einen Hocker nehmen. Laß dich mal anschauen. Wie lange sahen wir uns nicht? Zehn Jahre? Warum kamst du eigentlich nie? Wie? Ich wollte nicht? Oder, nein — du? Also gut. Ja, da bist du also.
Verändert? Nein, eigentlich nicht. Aber vielleicht doch? Natürlich, die Haare. Richtig, das trägt man jetzt. Halblang, mit Locken im Nacken. Ich habe manchmal die Frauen von Patienten gesehen. Nein — Alice hatte wohl noch lange Haare. Sie hat auch Naturlocken. In Zeitschriften habe ich es auch gesehen. Nur begreifen kann man’s erst, wenn man es sieht.“
Er streicht mit der Hand vorsichtig über die Locken im Nacken, hält Henriette, wie er es vom Gespräch mit Troplowitz gewohnt ist, an der Schulter fest, sucht ihren Blick zu fangen.
Aber sie sieht ihn nicht an, sondern das lebensgroße Bild von früher, die ölgemalte Fotografie mit dem feldgrau überzogenen Kürassierhelm, den Orden, dem überflüssigen Säbel und dem kleinen Schnurrbart über den lächelnden Lippen.
Dahl läßt Henriettes Schulter los und dreht sich langsam um. Er steht auf und besieht sein Bild nun auch aufmerksam. „Ja — wir haben uns doch verändert“, sagt er freundlich, „es ist nicht mehr dasselbe. Es ist vorbei. Lassen wir das.“
Henriette schüttelt den Kopf. Sie begreift nun gar nichts mehr. Sie weiß nicht mehr, was war und was nicht war, was lebt und was tot ist.
„Du mußt mir verzeihen“, sagt sie plötzlich. Das ist ihr im Gedächtnis geblieben. Das wollte sie sagen. Das sagt sie, obwohl es nun gar nicht mehr paßt.
„Verzeih mir. Es war so merkwürdig. Ich begreife es selber nicht mehr.“ Sie meint die Sache mit Wolfgang.
Dahl ist noch immer in die Betrachtung des Bildes versunken. „Nein, laß das“, sagt er flüchtig und leise. „Es ist vorbei. Wie die Kürassiere, die Orden, die Säbel. Man hat das mal getragen. Man wünschte sich das so. Es sah hübsch aus. Es war elegant und angenehm. Man wußte ja nicht, was dabei herauskam. Krieg aus Orden und Uniformen und stumpfen Säbeln, aus hohen Lackstiefeln und hohen Leidenschaften? Oder —?“
„Nein, ich hätte es nicht getan“, klagt Henriette verzweifelt. „Oder hätte man es doch getan? Konnten wir gar nichts anderes tun?“ schließt Dahl für sich.
Er steht jetzt am Fußende der Betten. Seine Hände gleiten über das glatte helle Holz. An was erinnert das nur? Wo ist er nur? Diese großen Ehebetten aus Kirschholz, die hellblauen Samtvorhänge, die dreiteilige Spiegeltoilette, die großen Hocker, die glatten Kleiderschränke. Er kennt das doch alles, obwohl dies Zimmer noch nicht eingerichtet war, als er zum letztenmal zu Besuch kam.
Henriette hat ihre Fassung schon wiedergewonnen. „Schön — nicht?“ lacht sie und legt ihre Hand auf Alfred Dahls Hand. „Ja, es ist alles genau so, aber es ist nicht dasselbe. Euer Schlafzimmer in Jedelbach steht noch unangerührt. Ich habe es nachbauen lassen beim selben Tischler in Breslau. Ganz genau. Ja, ich kannte es ganz gut. Ich war doch oft oben. Einmal gleich im Anfang, als ich sonst nur die Küche kannte und den Flur und — später manchmal, als deine Frau tot war. Nein, sonst durfte niemand hinein. Aber ich war manchmal drin. Da hat uns niemand gesucht.“
Wahrscheinlich würde sie noch lange weiterreden. Aber Alfred Dahl hält ihr den Mund zu. „Still“, flüstert er, „still. Genug. Wir wollen das nicht ausplaudern.“
Er zieht ihr vorsichtig das Kleid von den Schultern, so daß es zu Boden fällt, und legt sie ins Bett. Er löscht die Lichter bis auf die kleine Nachttischlampe, zieht sich auf dem Bettrand sitzend aus. Er kriecht zu ihr unter die Decke, hält sie in seinen Armen. Es ist nicht so schön, wie er geträumt, nicht so schrecklich, wie er gedacht hatte. Es ist sehr merkwürdig, eine fremde ältere Dame zu umarmen, in einem Bett, das nicht seines ist und doch genau wie seines von früher. Hier zu liegen, während oben in Jedelbach das gleiche Zimmer dunkel ist und wahrscheinlich modrig riecht.
Einmal geht die Gartenpforte, kommen leichte Tritte die Treppe herauf, flüstern zwei. Dahl fährt zusammen. „Der Junge“, flüstert er, „was macht denn der Junge? Wollen wir nicht dem Jungen guten Tag sagen?“
Aber jetzt hält ihm Henriette den Mund zu. „Nein, nein“, sagt sie, „morgen! Jetzt laß ich dich nicht. Jetzt halt ich dich. Jetzt habe ich dich.“
Aber wenn er auch den Kopf wieder auf die Kissen legt, sie hat ihn doch nicht. Seine Gedanken wandern schon wieder durch leere Zimmer und leere Jahre. Die Erinnerungen überwältigen ihn. Die Toten leben, zerren ihn von Henriette weg. Er muß mit ihnen gehen.
Er läßt sie langsam los, liegt starr, ein Gespenst, eine blasse Larve, eine schlechte Nachahmung Dahls in dem nachgeahmten Zimmer.
Als Jens Peter Dahl nach Hause kam, ein wenig naß von den Wiesen und von der Nachtkühle durchkältet, war er eigentlich hundemüde. Es war ja nun auch genug an Neuem und an Vergeblichem, und er dachte darum an gar nichts mehr. Das Haus war auch dunkel, denn die Nachttischlampe im Schlafzimmer der Mutter konnte man durch die dichten Vorhänge nicht sehen.
Jens Peter kletterte ein Stückchen am Weinspalier hoch. Dann zwängte er sich durch ein Fenster des Treppenhauses hinein, schurrte so leise wie möglich an der Mauer hinunter. Aber die Großmutter, Frau Kagen, mit ihren Feldmausohren hatte ihn doch gehört. Sie kam in ihren weichen, weiten Hausschuhen und einer etwas zerschlissenen Bettjacke der falschen Baronin herausgelaufen, so lautlos, daß der Junge sie erst bemerkte, als sie vor ihm stand.
Er fuhr zusammen. „Ach, laß doch, Großmutter“, sagte er ärgerlich, „was soll denn diese Aufpasserei?“
Aber sie legte ihm ihre beiden schmalen harten Hände auf den Mund. Sie zog sich dazu noch ganz zusammen, um genau auszudrücken, wie leise man sein mußte. „Er ist doch da“, sagte sie feierlich, „Gott sei Dank, er ist da. Zwei Stunden schon.“
„Ja — aber“, sagte Jens, „ja — wo denn? Es ist doch gar kein Licht.“
Frau Kagen lachte und zupfte ihren Enkel an den Haaren. „Ach, du Schafskopf“, flüsterte sie zärtlich. „Na, wo soll er wohl sein? Na, du brauchst es ja noch nicht zu wissen. Mit Fuffzehn. Da weiß man manches nicht. Da drin natürlich. Im Schlafzimmer.“
Wie gut, daß es dunkel war. Denn dem Stief schossen die Tränen in die Augen. Aber weil das die Großmutter nicht sah, konnte er ruhig ein bißchen lachen und burschikos sagen: „Na ja, natürlich. Daran habe ich gar nicht gedacht. Natürlich. Na, denn bis morgen.“
Er pfiff sogar leise vor sich hin, während er die Treppe in sein Zimmer hinaufschlich.
Oben aber setzt er sich ganz still in seinen großen geblümten Stuhl. Nein, daran hat er wirklich nicht gedacht. Wie merkwürdig! Er weiß doch sonst Bescheid. Ein Junge in seiner Lage! Den Vater und die Mutter hat er nie zusammen gedacht. Und nun? Nun fühlt er sich verraten.
Da kommt der Vater nach zehn Jahren aus der Anstalt. Und was macht er? Das, was die Leute draußen auch tun! Er geht ins Schlafzimmer. Als wäre nichts anderes zu tun, als wartete sonst niemand auf ihn.
Wirklich, er bleibt, was er war: einsam, verlassen, nicht hierhergehörig und nicht dahingehörig. Und alles wegen dieser blödsinnigen Geschlechtsdinge. Nein, nein. Das schwört er: das wird er nicht mitmachen. Nein, das gibt ja nur Unglück über Unglück, und es ist egal, wie man es macht. Verheiratet oder nicht verheiratet. Standesgemäß oder nicht standesgemäß. Immer gibt es Unglück.
Er zieht sich langsam aus, schichtet Stück für Stück sorgfältig übereinander. Die Hose erst, dann die Unterhose viereckig, die Strümpfe mit den Hacken nach oben. Erbittert stellt er die Stiefel davor, wäscht sich mit kaltem Wasser und einer harten Bürste von oben bis unten ab. Macht fünfzehn Rumpfbeugen und fünfundzwanzig Kniebeugen. Liegt im Bett und atmet sorgfältig.
Читать дальше