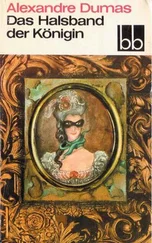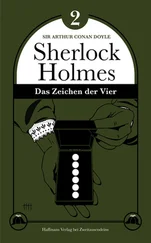Es war beinahe vierhundert Jahre her. Rodric selbst war auch in Val Thalas gewesen, aber nicht im Palast – es war ein Sommertag, erinnerte er sich, und er und Tyran hatten es irgendwie vollbracht, einige Wochen lang nicht in Ungnade zu fallen. Sie waren trinken gewesen, irgendwo in den Kaschemmen am Weißen Fluss, wo sie sich vor niemandem verneigen oder rechtfertigen mussten, und wo die Wahrscheinlichkeit gering war, auf jemanden zu treffen, den sie kannten.
Als sie zurückgekommen waren, hatten sie beide mit den Sinnen des Kriegers gewittert, dass etwas nicht stimmte. Wut, lodernde, brennende Wut erfüllte die Korridore. Angezogen von den Emotionen rannten sie beide in den Thronsaal, nur um mitten in eine Bestrafung zu stolpern.
Rodric erinnerte sich, wie er seine schwarze Rún hatte einsetzen müssen, um Tyran, impulsiv wie immer, davon abzuhalten, nach vorn zu stürzen, als Vetis siedendes Öl auf Elmas’ Unterarme und Hände goss.
Manchmal glaubte Rodric, noch nie jemanden so laut schreien gehört zu haben. Doch es war nicht nur der Schrei gewesen, der in seinen Ohren widerhallte – sondern auch das Summen der Scherbe, die spürte, dass eine andere ihrer Art ganz in der Nähe aktiviert worden war und benutzt wurde.
Lamia hörte nicht auf. Nicht, als das Blut aus Elmas’ Nase schoss. Nicht, als er bewusstlos wurde. Und als ein Rinnsal dunkler Flüssigkeit aus seinen Ohren tropfte, spürte Rodric das Bersten des Verstandes seines Kameraden.
Die Schmerzen durch das Öl waren eine Tortur gewesen, die er niemandem wünschte – aber die Folter durch die Scherbe hatte irgendetwas … mit Elmas gemacht. Rodric hatte zuvor schon Hinrichtungen mithilfe der Scherbe erlebt – schreckliche Momente, in denen er die Adern der Augen reißen sah, bevor die Iris sich in die Innenseite des Kopfes drehte, und der Delinquent zu Boden fiel – aber Elmas war nicht gestorben. Sie hatte nur irgendetwas in ihm … zerbrochen.
Jetzt taugte er nicht einmal mehr für die Blutgärten, in denen sich im Sommer die Gesellschaft Shaylas versammelte, um den Kämpfen zuzusehen.
Die Süße des Zuckers in seinem Mund erinnerte ihn schlagartig an das verbrühte Fleisch. Rodric schloss die Hände zu Fäusten.
»Nicht gut?«, fragte Elmas besorgt.
»Doch«, erwiderte Rodric. »Mir ist nur gerade etwas klar geworden.«
Ein Lächeln legte sich auf Elmas’ Züge.
Rodric erwiderte es.
Nämlich, dass ich alle Königinnen eines Tages töten werde.
Sklavenbaracken sahen überall gleich aus.
Diese Tatsache stand für Tyran nicht in Zweifel. Viel schlimmer jedoch: Sie rochen auch immer gleich; nach Schweiß und getrocknetem Blut und der sich ausbreitenden Resignation. Er hatte im Laufe seines Lebens so viele bewohnt, dass die Erinnerungen an die einzelnen Höfe manchmal zu verschwimmen drohten. Zugegebenermaßen war in einigen Anwesen die Unterbringung akzeptabler als anderswo gewesen, aber hier, in Oakwrath, befanden sich die Sklavenunterkünfte in holzverkleideten, doch gemauerten Häusern am rechten Rand der Festung. Zwischen den einzelnen Hütten gab es eine weitere Wasserpumpe und eine Kochstelle, die von den Sklaven eigenständig benutzt werden konnte. Für Tyran hatte es bisher noch nichts gegeben – er hatte, wie man ihm eindringlich erklärt hatte, für seinen Anteil des Essens noch nicht gearbeitet.
Das würde er vermutlich noch früh genug.
Tyran ignorierte seinen knurrenden Magen, während er nach einem passenden Versteck für den wenigen persönlichen Besitz suchte, den er mit sich führte. Es war üblich, dass man Sklaven vieles abnahm, aber einige kleine Gegenstände schaffte er fast immer zu verbergen. Im Kristallpalast, wo der Jäger die Oberaufsicht über die Sklaven hatte, ließ man ihm zudem auch ein wenig privaten Besitz, weil der Jäger schon seit der ersten Generation an jungen Kriegern, die er ausbildete, festgestellt hatte, wie weit manche von ihnen bereit waren zu gehen, um etwas zu behalten, was für sie einen ideellen Wert besaß.
Fast jeder von ihnen hatte so etwas, worauf er besonders achtete. Bei manchen war es ein Kleidungsstück oder ein Brief, eine Waffe, die sie von jemandem geerbt hatten. Tyran selbst waren nicht viele Erinnerungsstücke aus seiner Kindheit geblieben und danach hatte er kaum neue erworben.
Trotzdem machte er sich daran, eine der schmalen Pritschen beiseitezurücken. Feuchtigkeit war durch das Mauerwerk und die Holzverkleidung gedrungen, sodass eines der Bretter sich lösen ließ. Die Stelle war nicht gerade unauffällig – vermutlich war sie schon früher von jemandem benutzt worden. Tyran griff nach dem eng geschnürten Bündel, in dem sich unter anderem der Faustkeil befand, den Rodric ihm mitgegeben hatte. Vielleicht wäre dieser im Kristallpalast besser aufgehoben gewesen. Rodric hatte dort zumindest sein eigenes Zimmer. Hier, da brauchte Tyran sich keine Illusionen machen, würden sie die Gegenstände finden, wenn sie sich die Mühe machten, danach zu suchen. Sorgfältig verschloss Tyran das Loch und schob mit dem Schienbein die Pritsche wieder zurück an ihre vorherige Stelle.
Darauf lag seine Tunika. Einer der Sklaven, die für grobe Arbeiten in der Burg wie das Ausbessern des bröckelnden Mauerwerkes und für die Verarbeitungen des Eichenholzes ganz in der Nähe zuständig waren, hatte ihm eine Bürste gegeben, mit der er die Tunika von dem Schlamm der Straße hatte befreien können. Tyran verzog das Gesicht, als er sie hochhob. Sie hatte wirklich schon bessere Tage gesehen. Aber da Elnesta diese bekannte Vorliebe für Askyaner hatte, würde sie ihn wohl auch in seiner traditionellen Kleidung sehen wollen.
»Du weißt noch immer, wie man sich Feinde macht, Tyr.«
Einen Moment lang glaubte Tyran, es wäre Rodric, der ihn so spöttisch ansprach – doch noch im selben Moment verwarf er diese instinktive Vermutung. Es war eine andere Stimme, ein anderer Dialekt, der etwas gutturale askyanische Akzent, ganz anders als die Hochsprache Shaylas in der rauchigen Stimmlange seines besten Freundes.
Und dennoch löste der Satz die merkwürdige Empfindung einer halben Erinnerung aus, so, als hörte man die letzten Töne eines bekannten Liedes.
Tyran drehte sich um, noch während er hinter dem Rücken die Jagdtunika schloss.
Im Türrahmen der Baracke, die er sich mit einigen anderen Sklaven teilen würde, lehnte ein Sturmalb mit einem Bart, der genauso blond wie seine Mähne war.
Tyran blieb stumm. Das Gesicht … er kannte das Gesicht, doch …
Der Askyaner schien zu begreifen, dass die Wiedersehenserkenntnis ausblieb. Er lächelte nachsichtig – und mit eindeutigem Schalk in den Augen, die beinahe so blau waren wie Tyrans eigene.
»Tja, Ragnal«, neben ihm tauchte ein weiterer Sturmalb auf, der ihm zum Verwechseln ähnlich sah – nur hatte dieser sich die hellen Haare an den Schläfen ausrasiert. »Du bist wohl ein bisschen hässlicher geworden, sodass dich Tyr nicht mehr erkennt.« Für diese Bemerkung erntete er einen Schlag in die Magengrube, den er tapfer hinnahm, und in diesem Moment begriff Tyran, um wen es sich handelte.
Die beiden Männer waren keine anderen als seine Cousins aus Stormwood.
»Asbjorn«, nannte Tyran den fehlenden Namen, der ihm endlich wieder in den Sinn kam, Asbjorn und Ragnal Stormblood. Die Söhne seines Onkels. Es war Jahrhunderte her; fast sein ganzes Leben. Einst hatten sie in der Festung Stormhaven gemeinsam gelebt; sie waren ein wenig älter als er, und damals hatte es zu seinem Tagesinhalt gehört, seinen Vettern und ihren Freunden hinterherzulaufen und zu versuchen, sie bei jedem Unsinn zu übertreffen.
Das war gewesen, bevor Königin Lamia die Hälfte von Askyan erobert und Stormwood besetzt hatte. Es erschien ihm beinahe unwirklich.
Im nächsten Augenblick wich die Überraschung dem seltenen und deswegen umso köstlicheren Gefühl, die beiden tatsächlich wiedergefunden zu haben. Mit einem Lachen näherte er sich ihnen, sie teilten eine Umarmung, die damit endete, dass Asbjorn ihn auf Armeslänge von sich weghielt und ihn eingehend musterte.
Читать дальше