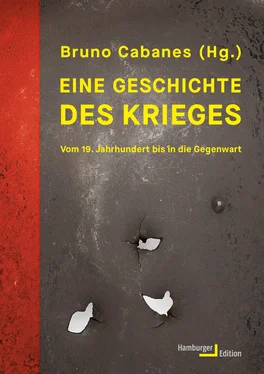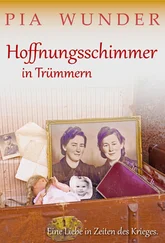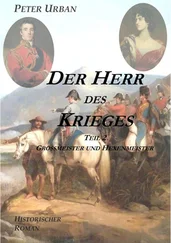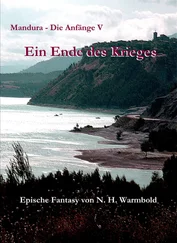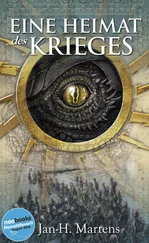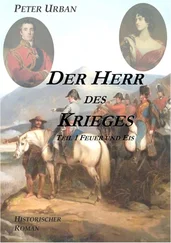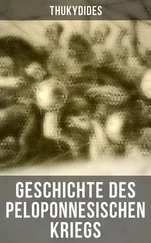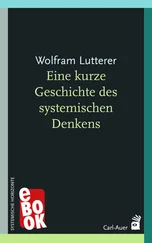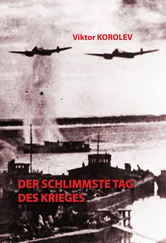Ab 1914 und vor allem während des Zweiten Weltkrieges wirkte sich der Konflikt auf mehreren Kontinenten, auf Tausende Kilometer entfernten, mehr oder weniger miteinander koordinierten Kriegsschauplätzen gleichzeitig aus. Ein historisches Novum war das nicht: Der Siebenjährige Krieg (1756–1763), in dem alle europäischen Großmächte in Europa, in Nordamerika, in Afrika, in Indien und auch auf den Meeren aufeinanderprallten, war bereits ein Weltkrieg gewesen. Indes bleibt der ungeheure Einsatz von Menschen und materiellen Ressourcen 1914–1918 unerreicht. Die beiden Weltkriege sind gelegentlich als Folge von Regionalkonflikten mit je nach Kriegsschauplatz verschiedenen Chronologien betrachtet worden. Auf dem Balkan beispielsweise bildeten die Kriege von 1912 und 1913, der Erste Weltkrieg und der Griechisch-Türkische Krieg (1919–1922) eine separate chronologische Abfolge. Die Erinnerungen an einen globalen Konflikt wie den Ersten Weltkrieg bleiben weitgehend dem nationalen Rahmen verhaftet: In Australien und in Neuseeland wird die Schlacht von Gallipoli als Geburtsstunde dieser jungen Nationen angesehen. Dort ist der 25. April 1915 nationaler Gedenktag (ANZAC Day) und wird im Gedenken an die Landung an den Dardanellen begangen. Für die Briten hingegen markierten die Umwandlung einer Freiwilligenarmee in eine Wehrpflichtigenarmee (27. Januar 1916) und die Schlacht an der Somme (Juli – November 1916) die entscheidenden Wendepunkte.
Auch der Zweite Weltkrieg spricht hier Bände: Japan lässt ihn 1931 mit dem Einmarsch in der Mandschurei beginnen, auch wenn dieser Krieg erst im Juli 1937 einen totalen Charakter annahm. Mit dem Angriff auf den amerikanischen Stützpunkt Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 wurde er zum »Großostasiatischen Krieg« – eine Bezeichnung, die 1945 von der amerikanischen Besatzungsmacht verboten und durch den Ausdruck »Pazifikkrieg« ersetzt wurde, bevor die akademischen Kreise in Japan, um die Ereignisse in der Mandschurei mit einzubeziehen, den Begriff »Fünfzehnjähriger Krieg«, und um den Amerikanisch-Japanischen Krieg mit den Kämpfen gegen China und gegen die Briten in Südostasien zu verknüpfen, den Begriff »Asien-Pazifikkrieg« populär machten. Für China endete der Krieg erst im Oktober 1949 mit dem Sieg der Kommunist*innen, für Korea mit dem Waffenstillstand von 1953, für Vietnam zweifellos 1975.
Es handelt sich um eine andere Form von »Totalwerdung« des Krieges, die, um nur die bedeutendsten Konflikte vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts herauszugreifen, im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865), im Deutsch-Französischen Krieg (1870–1871), im Zweiten Burenkrieg (1899–1902) in Südafrika, im Russisch-Japanischen Krieg (1904–1905) und den beiden Balkankriegen 1912 und 1913 sukzessive sichtbar wird. Was zeichnet diese Kriege aus? Die erste Veränderung, die, wie wir gesehen haben, bereits im Wechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert wirksam war, ist eine politische: Zur Rekrutierung, Ausbildung, Ausstattung und Entsendung von – überdies immer größeren – Wehrpflichtigenarmeen bedurfte es eines entwickelten Staatsapparats, einer ausgefeilten Infrastruktur, eines Schulungssystems, das die Individuen auf den »Waffendienst« vorbereiten konnte. 1870 hatten einer von 71 Franzosen und einer von 34 Deutschen eine Militärausbildung durchlaufen; 1914 waren es einer von 10 Franzosen und einer von 14 Deutschen. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges hatten alle europäischen Länder mit Ausnahme Großbritanniens eine Wehrpflichtigenarmee.
Die zweite Veränderung, die mit der ersten im Zusammenhang steht, ist ideologischer Natur. Eine »Nationalisierung der Massen«, um den Begriff des großen Historikers George L. Mosse aufzugreifen, funktioniert durch die Schaffung von Institutionen und Symbolen, die mit patriotischer Bedeutung aufgeladen sind, durch den Aufbau riesiger Armeen von Bürgersoldaten, die Marginalisierung und Verfolgung derjenigen, deren Loyalität als fraglich gilt oder die als nicht assimilierbar angesehen werden: Die Idee der »nationalen Gemeinschaft« gipfelt in kriegsorientierten Gesellschaften wie dem nationalsozialistischen Deutschland, dem faschistischen Italien oder dem stalinistischen Russland, wo die ethnischen, religiösen und nationalen Minderheiten die bitteren Folgen tragen mussten. Die Grenze zwischen Krieg und Frieden wurde zunehmend porös: Die Sowjetunion führte zu politischen Zwecken im Inneren einen Krieg gegen die ethnischen Minderheiten mit Mitteln, die aus Kriegszeiten bekannt waren (beispielsweise Beschlagnahmung von Getreide): Die große Hungersnot in der Ukraine, der zwischen 1931 und 1933 mehr als 6 Millionen Menschen zum Opfer fielen, ist das größte Massenverbrechen des Stalinismus. Die Macht der nationalen Ideologien trug zur Entstehung von Auseinandersetzungen neuen Typs bei – wie dem Deutsch-Sowjetischen Krieg, in dem der Zusammenprall des Stalinismus und des Nationalsozialismus zwischen 1941 und Mai 1945 die Bedingungen für einen Vernichtungskrieg schufen, oder dem Pazifikkrieg mit seiner rassistischen Komponente, den der Historiker und Japanspezialist John Dower mit gutem Grund einen »Krieg ohne Gnade« 9nennt.
Die dritte Veränderung betraf die rechtliche, humanitäre und ethische Ebene: die Auflösung der ohnehin schon durchlässigen Grenze zwischen Kombattant*innen und Nichtkombattant*innen. Halten wir dennoch fest: Es steht ganz außer Frage, dass Nichtkombattant*innen seit Jahrhunderten massenhaft Kriegen zum Opfer gefallen waren. Man denke nur an die Plünderung Magdeburgs (20. Mai 1631) während des Dreißigjährigen Krieges, bei der rund 25 000 Zivilist*innen niedergemetzelt wurden und die mit solcher Grausamkeit durchgeführt wurde, dass infolgedessen das Verb »magdeburgisieren« entstand. Die Periode von 1860 bis 1945 sticht nicht durch die Masse an getöteten Zivilist*innen heraus, sondern durch die Tatsache, dass ihre Zahl am Ende bei Weitem die Verluste an Soldaten überstieg: Sie machten 65 Prozent der Todesopfer im Zweiten Weltkrieg gegenüber ungefähr 10 Prozent im Ersten Weltkrieg aus – ein Zeichen dafür, dass im Prozess der Totalwerdung des Krieges ganz bewusst zunehmend die Nichtkombattant*innen ins Visier genommen wurden: als Opfer von Städtebombardements, von Blockaden, von Genoziden …
Diese Angriffe auf die Zivilbevölkerung waren von einer entgegengesetzten Tendenz zur Regulierung des Krieges begleitet, die durch die Haager Landkriegsordnung von 1899 und 1907 an Fahrt aufnahm. Allerdings verfügte Letztere über keinerlei Durchsetzungsmechanismen. Letztlich bestand eine permanente Diskrepanz zwischen den Rechtsverletzungen gegen Nichtkombattant*innen in Europa, die heftige Reaktionen bei Politiker*innen und Jurist*innen (der Bryce-Report von 1915 über die »deutschen Gräuel« in Belgien) sowie bestimmten Künstler*innen auslösten (Picassos Guernica von 1937, gemalt nach der Bombardierung eines baskischen Dorfs durch die deutsche Luftwaffe während des Spanischen Bürgerkrieges), und der Banalisierung derselben Gewalthandlungen innerhalb des Imperiums oder außerhalb Europas, die auf eine breite Front der Gleichgültigkeit stießen, wenn man von wenigen aufgeklärten Geistern wie André Gide absieht. Als sich H. G. Wells in seinem Science-Fiction-Roman The War in the Air (1908) die Bombardierung New Yorks durch »Luftschiffe« ausmalt, schreibt er, sie hinterließen »Ruinen und lodernde Feuersbrünste und aufgehäufte und umhergestreute Tote: Männer, Weiber und Kinder – alles durcheinander, als wären sie nichts weiter als Neger, Zulus oder Chinesen«. 10
Die vierte Veränderung ist die technologische Entwicklung infolge der zweiten industriellen Revolution im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts (billiger Stahl, moderne Chemie, Verbrennungsmotor). Beispiele sind das während des Amerikanischen Bürgerkrieges entwickelte Minié-Geschoss; der Stacheldraht, dessen Erfinder, ein amerikanischer Viehzüchter in Illinois, sich 1874 kaum ausgemalt haben konnte, wie seine Erfindung vierzig Jahre später auf dem no man’s land der Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges eingesetzt würde; die Maschinengewehre, die Granaten, die chemischen Kampfstoffe, die Flammenwerfer, die Jagdflugzeuge und Bomber, die Panzer bis hin zu der einschneidenden Erfindung der Atombombe – außerdem im Bereich der Versorgung Verwundeter und Kranker: die Röntgenstrahlung, die Bluttransfusion (ab 1914) und das Penizillin (ab 1942). Innerhalb weniger Jahrzehnte veränderte der technologische Fortschritt die Erfahrung auf dem Schlachtfeld: Die Luftfahrt, später das Radar und das Sonar (in den 1930er Jahren) sowie die Satelliten (in den 1960er Jahren) erlaubten der militärischen Aufklärung, sich über den Horizont zu erheben; die drahtlose Telegrafie (seit 1894) und später der Funk (womit die deutschen Panzer während des Blitzkrieges 1940 ausgestattet waren, während die französischen Panzerfahrzeuge noch mit Fähnchen kommunizierten) erleichterten die Übermittlung von Befehlen; die Eisenbahn war bis zur Erfindung des Flugzeugs und später des Hubschraubers (ab den 1950er Jahren) unverzichtbar für die Mobilisierung und den Truppentransport. Das bedeutet allerdings weder zwangsläufig, dass diese technologischen Revolutionen auf dem Schlachtfeld entscheidend waren (die Technologie ist nichts ohne die Strategie), noch dass sie nicht auch auf Unverständnis oder Widerstände unterschiedlichster Form getroffen wären. Dem ist noch hinzuzufügen, dass es in bestimmten Perioden zu einer beschleunigten Entwicklung kam: Ein Heerführer aus dem Sezessionskrieg und sogar aus den Napoleonischen Kriegen hätte im Großen und Ganzen ein Schlachtfeld des Sommers 1914 wiedererkannt. Aber ließe sich dasselbe auch für einen General des Jahres 1914 bezüglich der Situation vier Jahre später sagen?
Читать дальше