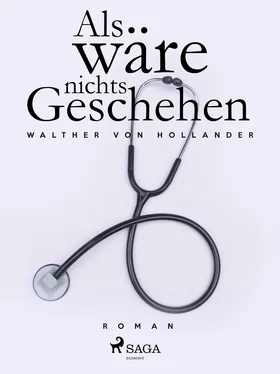1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Er schaute zu Christina hinüber. Er sah im Schein der Lampe deutlich nur ihre Hände, schmale, ziemlich lange, geschickte Hände, die Lineal, Zirkel und Zeichenfeder sicher handhabten. Dahinter, schon undeutlicher, das knallrote Halstuch in der weißen Flauschjacke. Müßte man tuschen, wenn man einen Tuschkasten hätte. Er trat an ihren Tisch heran und rollte ihr wieder eine Zigarette über die Platte. Sie rollte die Zigarette zurück. „Ist mir zuviel“, sagte sie und hielt ihm wieder das brennende Feuerzeug entgegen. Er sah jetzt endlich ihr Gesicht genauer, das hübsche Pferdegesicht mit der zarten, kühnen Nase, umrahmt von harten, blonden Haaren, die sie zu straff zurückgebürstet trug. „Wenn man Sie ansieht“, sagte er, „merkt man erst, wie verkommen man ist.“ Sie blickte eine Sekunde abwehrend auf. Sie hatte dunkelblaue Augen mit übermäßig langen Wimpern. „Entschuldigen Sie. Es betraf nicht unser beider Seelenleben. Ich meinte nur, Sie haben doch bestimmt auch kein Geld. Und nun schauen Sie mich mal an und dann einen kurzen Augenblick sich selbst, falls Ihnen das nicht unangenehm ist.“
„Besonders gern schau’ ich mich nicht an“, sagte sie unbeteiligt. „Wiedersehen“, winkte Conrad und begann wieder seinen Marsch in die Dämmerung.
„Wiedersehen“, sagte sie, „und wenn Sie noch einen Tee wollen, dürfen Sie ruhig noch mal auftauchen.“
„Schenken Sie nur ein“, sagte Conrad, „ich werde gelegentlich vorbeikommen.“
Weiter wurde an diesem Abend nichts gesprochen. Conrad ging gedankenlos und zufrieden auf und ab. Es war ganz hübsch, fand er, daß er nicht allein war, und noch hübscher fand er es, daß diese schöne junge Frau ihn nichts anging. Schade, daß man nicht öfter mit ganz unbekannten Menschen zusammen sein konnte. Mit Menschen, deren Schicksale, deren Lebenskreis, deren Ansichten, deren Kämpfe und Leiden man nicht kannte. Mit Unbekannten bekannt sein ... das war ein Conradscher Wunsch. Mit solchen unerfüllbaren Wünschen spielte er gern. Und warum sollte es in diesem Falle nicht möglich sein? Nun — schon deshalb nicht, weil er ihr Schicksal kannte. Aber er brauchte ja davon nicht Kenntnis zu nehmen. Vielleicht ging das, und man kam in eine Art von fremder Vertrautheit. Auch so ein unerfüllbarer Wunsch, den er sein Leben lang gehabt hatte. Aber sollte man solche Dinge nicht wenigstens versuchen? Die alten und bekannten Beziehungen der Menschen untereinander waren so, daß man nach einer neuen Art von Beziehungen Ausschau halten sollte. Gut ... das konnte man versuchen.
So weit waren seine Gedanken, als draußen ein Pfiff ertönte. Der Pfiff einer Trillerpfeife. Christina horchte. Sie legte ihre Zeichengeräte fort, setzte sich hastig ihr Samtkäppchen auf und reichte Conrad die Hand: „Es ist nodi Tee da, wenn Sie mögen.“
„Nein, danke“, sagte Conrad schroff. Sie sah ihn fragend an: „Wenn ich Sie bestimmt nicht störe ... ich muß morgen abend wieder hier arbeiten.“
„Es ist mir ganz einerlei, ob Sie hier sind. Ich marschiere, und Sie zeichnen.“
„Also auf Wiedersehen“, sagte sie, schon in der Tür. Er horchte ihr nach, wie sie hastig über den Kies davonlief. Dann mußte er laut lachen. Bekanntschaft mit einer Unbekannten! Und schon dachte er darüber nach, weshalb sie auf einen Pfiff hinauslief, mit wem sie, die scheinbar Unnahbare, verabredet war, mit wem sie, die scheinbar Schweigsame, jetzt, Arm in Arm und sicherlich lustig schwätzend, durch die Mondnacht ging. Es war Zeit, daß er sich zurückzog. Er ging in seine Kammer und knallte ärgerlich die Tür hinter sich zu.
Dann fiel ihm der Tee ein. Er ging noch einmal hinaus, goß sich eine Tasse voll. Tee konnte sie wirklich kochen. Er trank behaglich und genießerisch.
Er räumte das Geschirr zusammen, wusch es an der Wasserleitung, trocknete die Kanne und die Tassen ab und stellte sie sauber auf den Schreibtisch. Die Dahlie hatte sie vergessen. Er nahm die rote Blüte und stellte sie an Stelle des Deckels in die Teekanne, nachdem er Wasser eingegossen hatte. Wird wahrscheinlich dem Tee von morgen schaden, dachte er. Aber es sah hübsch aus. Zufrieden pfeifend ging er nun endgültig in seine Zelle zurück.
Grübeleien im Regen und ein Besuch
Es regnete. Conrad lag halb aufgerichtet im Bett. Es hatte keinen Zweck, aufzustehen. Der Herbst war endgültig da. An dem Gitter der Gerätekammer schaukelten die gelben Lindenblätter vorbei, die noch grelleren der Platanen aus dem Nachbargarten. Die kleine japanische Lärche zeigte Spuren eines schmutzigen, rostigen Gelbs. Es waren die larix japonica, der platanus orientalis und die tilia parvifolia, die herabblätterten. Hannes Hohmann hatte sie Conrad aufgezählt. Er liebte es, zu beweisen, daß er, der Werkmeisterssohn aus Pankow, eine höhere Bildung genossen, ein gründliches Studium der Wissenschaften hinter sich gebracht hatte. Alles aus eigener Kraft. Nichts verdankte er anderen.
Doch: seiner Frau verdankte er ziemlich viel. Daß er noch auf den Beinen stand, daß er sich das Saufen abgewöhnt hatte und jene Ausbrüche der Zerstörung im Rausch, in denen er früher drei- oder viermal fast die ganze Wohnung zertrümmert hatte. Er verdankte es ihr, daß er nicht mit der schwarzhaarigen Gräfin Süttorph nach Brasilien ausgewandert war und nicht auf dem Schloß der reichen Frau Kleienberg ein faules, nichtsnutziges Leben führte. (Du bist ein Herr, und dir kommt ein Herrenleben zu — hatte Frau Kleienberg gesagt.) Hilla verdankte er es, daß er manchmal seine eignen Ideen durchsetzte und zuweilen ein hübsches, wohnliches und doch originelles Haus baute. Außer den Schokoladenhäuschen, den Marzipanvillen, den neonbelichteten Tankstellen, die er am laufenden Band produzierte, damit „der Schornstein rauchte“.
Conrad hörte ihn nebenan gutgelaunt lärmen. Mit kräftigsten Soldatenwörtern trieb er seine „Sklaven“ an. „Alles Scheiße“, war noch der harmloseste Ausdruck. Conrad haßte die Soldatensprache. Er hatte sie genug und übergenug gehört und gesprochen. Der Mensch oberhalb des Nabels schien ihm jetzt anziehender. Er betrachtete eingehend die vergilbenden Nadeln der larix japonica. Seine Mallehrerin hatte einmal gesagt, daß man alles zeichnen kann, was man wirklich sieht, und daß man nichts richtig sieht, was man nicht zeichnen kann. Ganz hübsche Theorie. Man müßte sie mal ausprobieren. Aber er rauchte ja, statt sich einen Tuschkasten zu kaufen. Freilich hätte er es nur Hannes zu sagen brauchen. Der hätte ihm bestimmt den größten Tuschkasten geschenkt, der in Hamburg aufzutreiben war. Groß wie ein Wagenrad. Aber er wollte nichts mehr geschenkt nehmen. Es genügte wahrhaftig, daß er umsonst hier wohnte, daß ihm Hilla jeden Morgen Briketts vor die Tür stellen ließ, daß er ab und zu oben bei Hohmanns zu Mittag aß oder abends zu einem Glas Wein eingeladen wurde, wenn nette, amüsante oder „wichtige“ Leute da waren. Es hatte übrigens wenig Sinn, daß er mit diesen Menschen zusammensaß, die „Wichtigen“ blieben ihm recht unwichtig, und die netten und amüsanten kamen ihm albern vor, manchmal auch gespenstisch. Hatten sie eigentlich nichts Schlimmes mitmachen müssen? Wußten sie nicht, daß Millionen von Menschen endgültig aus ihrem Leben vertrieben waren, daß es Hunderttausende gab, in deren Dunkelheit kein Licht schien, über deren Leben die Sonne nie wieder aufgehen würde? Natürlich wußten sie es. Aber sie waren ja „nicht daran schuld“, und „sie konnten es nicht ändern“. Sollten sie sich etwa bescheiden? Das „nützte niemandem“.
„Wer wirklich will“, hatte bei solcher Gelegenheit Hannes dröhnend verkündet, „wer wirklich will, mein Lieber, der kommt auch wieder hoch. Für die Alten und Kranken: jedes Mitleid! Bitte. Aber die anderen sollen sehen, wo sie bleiben.“ Komisch — dem guten Hannes nahm er seine taktlosen und selbstbewußten Kraftsprüche nicht übel. Er hatte eben ein Kraut-und-Rüben-Gehirn. Aber er hatte auch eine unbändige Kraft, eine herrliche gedankenlose Durchsetzungsfähigkeit. Er stellte was hin. Gute Häuser, schlechte Häuser. Aber Häuser. Es kommt nur darauf an, daß man Kraft hat, dachte Conrad. Kraft! Man mußte doch nur mal sehen, wie Hannes unbekümmert sein Leben führte, wie er alles tat, was ihm durch den Kopf fuhr, Gutes, Dummes und Schlechtes, je nachdem. Und was er der wunderbaren Hilla antat mit seiner Gedankenlosigkeit, seinem wahnwitzigen Temperament, seinen kleinen Schurkereien. Womit mußte er das bezahlen? Er mußte überhaupt nicht bezahlen. Er bekam dafür die unerschöpfliche und harmonische Liebe Hillas geschenkt. Und er, Conrad? Was hatte er je bekommen mit allem Anstand, mit dem ständigen Bemühen, sich den Wünschen und Vorstellungen Ilses anzupassen? Mißtrauen hatte er geerntet, stumme und laute Vorwürfe, entsetzliche nächtelange Auseinandersetzungen, wie das Verhältnis der Geschlechter zueinander zu sein habe. Nämlich ernst, sauber und tief. Sie hatte recht. So sollte es auch sein. Und man sollte einander treu sein. Es war nicht nur das Beste. Es war auch das Vernünftigste. Nur Conrad war eben nicht immer vernünftig. Leider.
Читать дальше